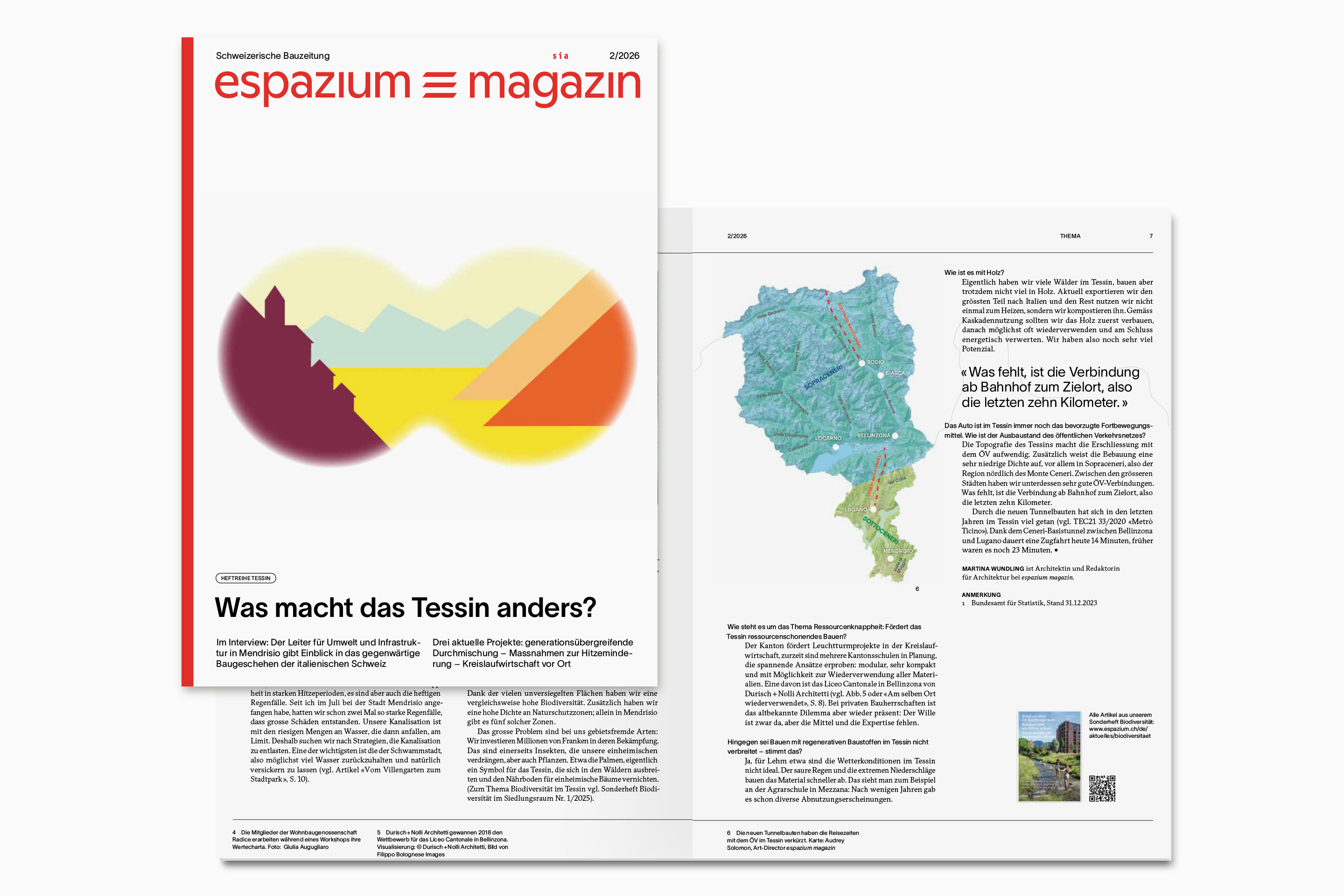Potenzial im Einfamilienhaus
Im Verhältnis zur Lebensdauer eines Gebäudes ist das Einfamilienhaus nur für kurze Zeit das Haus einer Familie. Die längste Zeit wohnen eine bis zwei Personen auf viel Raum, der ihren Bedürfnissen oft nicht mehr gerecht wird. Das Umnutzungspotenzial ist gewaltig, aber nur schwer zu aktivieren.
Der Traum vom Einfamilienhaus ist lebendig und wohlauf. Jahr für Jahr kommen Umfragen wie die Wohntraumstudie der Helvetia zum gleichen Fazit: Das Einfamilienhaus auf dem Land ist das ungebrochene Wohnideal der Schweizer Bevölkerung. Ein Haus für sich, mit Grün drumherum, da hat man ausreichend Platz, da kommt man zur Ruhe, kann sich erholen, hat seine Freiheit, kann selbst bestimmen. Das Ideal bleibt für die allermeisten ein Traum: Laut einer Studie des Bundesamts für Wohnungswesen können 80 % der Menschen, die sich Wohneigentum wünschen, es sich laut eigenen Angaben nicht leisten.
Ein bis zwei Personen pro Haus
Das Wohnideal widerspiegelt sich auch in der Gebäudestatistik des Bundes: Das Einfamilienhaus ist mit einem Anteil von 57 % der häufigste Wohngebäudetyp in der Schweiz. In 55 % dieser Häuser wohnen ein bis zwei Personen, insgesamt etwa ein Viertel der Schweizer Bevölkerung. Umgekehrt präsentiert sich die Situation der Mehrfamilienhäuser: Etwas mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung lebt in Mehrfamilienhäusern, die mit 27.7 % gut ein Viertel der Wohnbauten im Land ausmachen. Die restlichen knapp 15 % der Wohngebäude sind gemischt genutzt.
Ein typologischer «Bastard»
Historisch betrachtet ist das Einfamilienhaus ein junges Phänomen, das sich erst in der Nachkriegszeit rasant ausbreitete. Die Bezeichnung eines Gebäudes als «Einfamilienhaus» beginnt erst ab 1900, und damals wurden nur wenige solcher Häuser überhaupt gebaut. 1905 etwa entstanden laut dem statistischen Jahrbuch Zürich von 1940 auf Zürcher Stadtgebiet nur rund 20 Villen oder Einfamilienhäuser pro Jahr, während in den 1920er-Jahren etwa 200–300 Einfamilienhäuser pro Jahr gebaut wurden.1
Bautypologisch ist das Einfamilienhaus ein «Bastard»2 irgendwo zwischen proletarischem Siedlungshaus, bürgerlicher Villa und dem Chalet. Zentrale Komponente dieser Wohnform war dabei schon immer auch das Eigentum: «Der Besitz eines Hauses mit Garten bildete eine positive Gegenwelt zu den Zwängen einer hierarchischen Arbeitswelt.»3 In der Nachkriegszeit nimmt der Einfamilienhausbau im Zusammenspiel mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und dem Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen neue Dimensionen an.
Das Einfamilienhaus wird zur architektonischen Verkörperung der bürgerlichen Lebensform Kleinfamilie, die gegen Mitte des 20. Jahrhunderts zur Lebensrealität einer aufsteigenden Mittelklasse wurde (vgl. «Leben im amerikanischen Traum»). Die meisten Einfamilienhäuser der Schweiz entstanden zwischen 1960 und 2000, im Rekordjahr 1980 waren es fast 17 000 Einfamilienhäuser schweizweit.4
Vom Traum zur Belastung
Einige der Probleme dieser Einfamilienhäuser liegen auf der Hand: Im Vergleich zum Mehrfamilienhaus leben weniger Menschen auf mehr Boden, viele Einfamilienhausquartiere sind nur mit dem Auto bequem zu erreichen und ein Grossteil der Gebäude hätte altersbedingt eine energetische Sanierungskur nötig.
Andere, tiefer gehende Probleme des Einfamilienhauses gründen in unflexiblen Nutzungsmöglichkeiten und zeigen sich erst mit der Zeit, wenn die Kinder längst ausgezogen sind. Wer 1980 mit der jungen Familie in eines der 17 000 neu erstellten Einfamilienhäuser einzog, lebte höchstens bis Anfang Nullerjahre als Familie dort. Seither stehen die Kinderzimmer meist leer, das oberste Stockwerk verstaubt zusehends, ein Gästebett wartet unter einem Überwurf auf Besuch.
Lesen Sie auch:
Umbau Ackersteinstrasse: Ein harmonisch ungleiches Paar
Baubüro in situ sanierte ein im Jahr 1937 erstelltes Einfamilienhaus in Zürich. Ergänzt mit einem Anbau ergaben sich daraus drei neue, sehr unterschiedliche Geschosswohnungen.
Nun, weitere 25 Jahre später, haben sich mit zunehmendem Alter die Bedürfnisse der verbleibenden ein bis zwei Bewohnenden verändert. Die Treppen werden zum Hindernis, das Putzen ist anstrengend bis gefährlich, die Ölheizung kann bald ins Museum, der schöne grosse Garten überwuchert und man zieht sich im Alltag auf wenige Zimmer zurück.
Mangelnde Alternativen
Die Bundesstatistik weist nicht zufällig bei Menschen über 65 einen Wohnflächenverbrauch von über 70 m2 aus, während der Durchschnitt von Familien bei 32 m2 pro Person liegt. Alleine im zu grossen Haus weiter zu wohnen ist selbstverständlich das Recht jedes Hausbesitzers, jeder Hausbesitzerin. Für viele ist dies aber gar kein bewusster Entscheid, sondern einfach ein Status quo mangels attraktiver Alternativen.
Dass sich auch die Option einer Umnutzung innerhalb des Hauses anbieten könnte, daran denken viele wohl gar nicht erst. Hier setzt Mariette Beyeler mit ihrem Buch «Weiterbauen»5 und dem Verein «MetamorpHouse» an, der mit zahlreichen Praxisbeispielen und Inputs zu Themen wie Finanzierung und rechtlichen Fragestellungen Besitzerinnen und Besitzer von Einfamilienhäusern dazu ermutigen will, die Zukunft ihres Hauses selbst in die Hand zu nehmen. Damit treiben sie auch die qualitative Innenentwicklung von Quartieren mit tiefen Dichten durch das Bauen im Bestand voran.
Potenzial Innenverdichtung
Wäre die Innenentwicklung ein Videogame, wäre das Einfamilienhaus der Endgegner. Denn obwohl das Potenzial gewaltig ist, erweist sich dessen Aktivierung aufgrund der kleinteiligen Parzellierung, heterogenen Eigentümerschaften und fehlender Skalierungseffekte als besonders schwierig. Jedes Haus, jede Parzelle, jede Eigentümerschaft braucht eine eigene Lösung. Oft bestehen Baureserven und es könnte aufgestockt oder angebaut werden (vgl. «Die Hindernisse sind in den Köpfen»).
Darin liegt aber auch das Potenzial von Einfamilienhäusern als gestalterisches Aufgabenfeld: Die beste Lösung für ein neues oder sich änderndes Nutzungsszenario auszuarbeiten ist eine Kernkompetenz der architektonischen Disziplin. Ein zukunftsfähiges Tätigkeitsfeld also, in dem – zumindest statistisch gesehen – knapp eine Million Bauherrschaften und Objekte auf gute Ideen warten. An die Arbeit!
Anmerkungen
1 Daniel Kurz, Disziplinierung der Stadt. Moderner Städtebau in Zürich 1900 bis 1940, Zürich: gta Verlag 2022, S. 74.
2 Benedikt Loderer, Die Landesverteidigung. Eine Beschreibung des Schweizer Zustands, Zürich: Edition Hochparterre 2012, S. 93.
3 Stefan Hartmann, (K)ein Idyll – Das Einfamilienhaus.
Eine Wohnform in der Sackgasse, Zürich: Triest 2020, S. 50.
4 Ebd., S. 70.
5 Mariette Beyeler, Weiterbauen. Wohneigentum im Alter neu nutzen, Basel: Christoph Merian Verlag 2010.