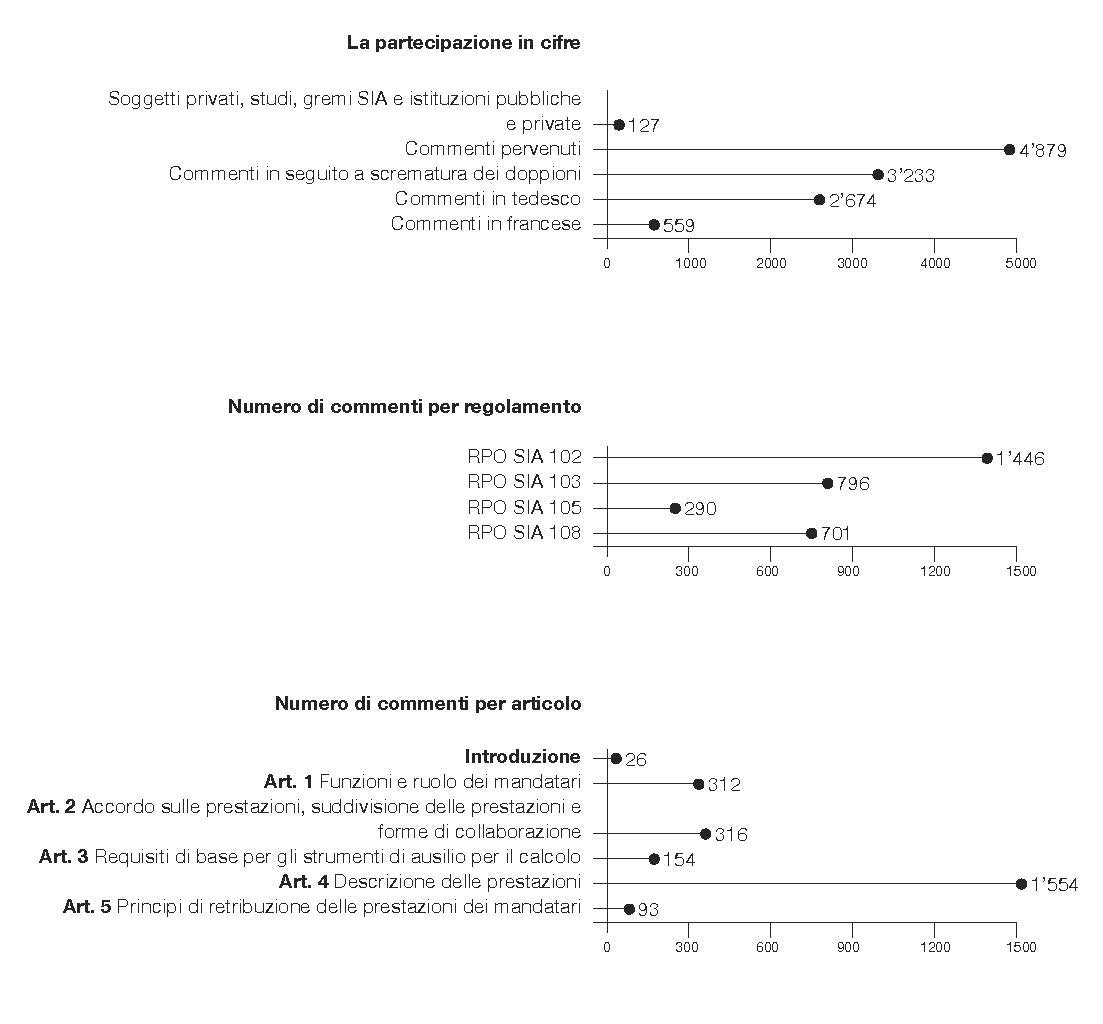Das Erbe von Frauen sichtbar machen
Was als denkmalwürdig und damit bewahrenswert gilt, ist eine Frage gesellschaftlicher Aushandlung. Charten und Leitsätze, aber auch Kampagnen, bringen diesen Prozess voran. Im besten Fall inspirieren sie gesellschaftliche Strukturen und die gelebte Praxis gleichermassen.
Das Europäische Jahr für Denkmalschutz von 1975 war ein grosser Schritt, um die Bevölkerung für die Bedeutung des baukulturellen Erbes zu sensibilisieren. Das Denkmalschutzjahr popularisierte auch die Betrachtung räumlicher Zusammenhänge, die 1964 bereits in der Charta von Venedig formuliert wurde: «Der Denkmalbegriff umfasst sowohl das einzelne Denkmal als auch das städtische oder ländliche Ensemble.» In der Schweiz fiel das Denkmalschutzjahr nicht nur mit dem Start des Inventars schützenwerten Ortsbilder (ISOS) als erstem Bundesinventar zusammen, sondern beflügelte auch die Institutionalisierung der Denkmalpflege.
Eine Zukunft für ihre Vergangenheit
Die fachliche Konzeption des vom Europarat initiierten Denkmalschutzjahres lag weitgehend bei Alfred A. Schmid, dem langjährigen Präsidenten der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege (EKD). Die Initiative lief unter dem Motto: «Eine Zukunft für unsere Vergangenheit?» Zum 50-jährigen Jubiläum des Europäischen Denkmalschutzjahres knüpft eine Kampagne von ICOMOS Schweiz, der Landesgruppe des Internationalen Rats für Denkmalpflege, aktuell an dieses Motto an.
Die Frage lautet nun: «A future for whose past?» Die Frage ist also, wer mit «unser» Erbe gemeint ist und wessen Erbe fehlt. Wie schon das Europäische Denkmalschutzjahr greift die Kampagne von ICOMOS Schweiz einen bereits zuvor formulierten Gedanken auf. In den Leitsätzen der EKD von 2007 heisst es: «Durch ihre Denkmäler schützt und vertieft die Gesellschaft ihre Identität sowie Toleranz und Solidarität mit verschiedenen Gruppierungen, namentlich auch mit Minderheiten.»
Gelebte Praxis ist dieser Anspruch noch nicht überall. Grund genug für den SIA, am 9. September 2025, im Rahmen des Formats «Rundum–SIA» die Frage «A future for her past?» zu diskutieren.
Blick ausweiten
In der Schweiz hat es lange gedauert, bis Frauen Architektur studieren, wählen und eigenständig Verträge unterschreiben durften. Und lange mussten Architektinnen um ihre Anerkennung kämpfen. Entsprechend mager ist bisher auch das baukulturelle Erbe von Frauen in den Denkmalinventaren vertreten.
Ein prominentes Beispiel für das baukulturelle Erbe von Frauen ist der Pavillon der Architektin Berta Rahm, der im Rahmen der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit (Saffa) von 1958 als Annex-Gebäude am linken Zürichseeufer errichtet wurde, dann einer Pilzzuchtfabrik diente und schliesslich zerstört werden sollte.
Die Abbruchbewilligung lag bereits vor, der Verein «ProSaffa1958-Pavillon» konnte den Pavillon jedoch retten, lagerte ihn mit Hilfe von Handwerkern ein und sucht seither nach einem geeigneten Standort für den Wiederaufbau. Ein Hoffnungszeichen für den Wiederaufbau des Pavillons gab der Zürcher Gemeinderat im November 2024. Mit grosser Mehrheit überwies er das Postulat «Wiederaufbau des eingelagerten Berta-Rahm-Pavillons» dem Stadtrat zur Prüfung.
Nina Hüppi, Kunsthistorikerin und Co-Präsidentin des Vereins «ProSaffa1958-Pavillon», regte am SIA-Anlass an, den Blick über Architektinnen hinaus auszuweiten. Auch als Eigentümerinnen und Bauherrinnen seien Frauen am Bau beteiligt. Aus dem Publikum kam zudem die Anregung, weitere Kriterien, beispielsweise sozialgeschichtliche, für die Denkmalwürdigkeit in Betracht zu ziehen, zumal die Zuschreibung von Autorinnenschaft gerade bei Bauprojekten in Partnerschaften häufig schwierig sei.
Mit Blick auf den Pavillon von Berta Rahm betonte ETH-Professorin Silke Langenberg, die auch die Arbeitsgruppe «A future for whose past?» von ICOMOS Schweiz leitet, zugleich: «Das ist auch ein gutes Stück Architektur.»
Zu reden gab ausserdem das Thema Frauen in der Architektur heute, wobei unterschiedliche Auffassungen zu gesellschaftlichen Zuschreibungen zum Ausdruck kamen. Eine jüngere Person aus dem Publikum wies darauf hin, dass es auch Männer mit einer weiblichen, weichen Seite gebe.
Zwar hat sich bei den Architektinnen viel getan, wie Silke Langenberg unter anderem mit einer Fotogalerie von ETH-Professorinnen illustrierte. Zugleich sind Frauen in der Bau- und Planungsbranche noch immer untervertreten, sei es in Leitungsfunktionen und bei Auszeichnungen, oder wenn es um Verbandsmitgliedschaften, Einsitz in Fachpreisgerichten oder um den Lohn geht. Kampagnen wie «A future for whose past?» zielen darauf ab, zu einem Wandel gesellschaftlicher Strukturen beizutragen. Da das Zeit braucht und auch private Entscheidungen zählen, riet Silke Langenberg: «Augen auf bei der Partnerwahl!»