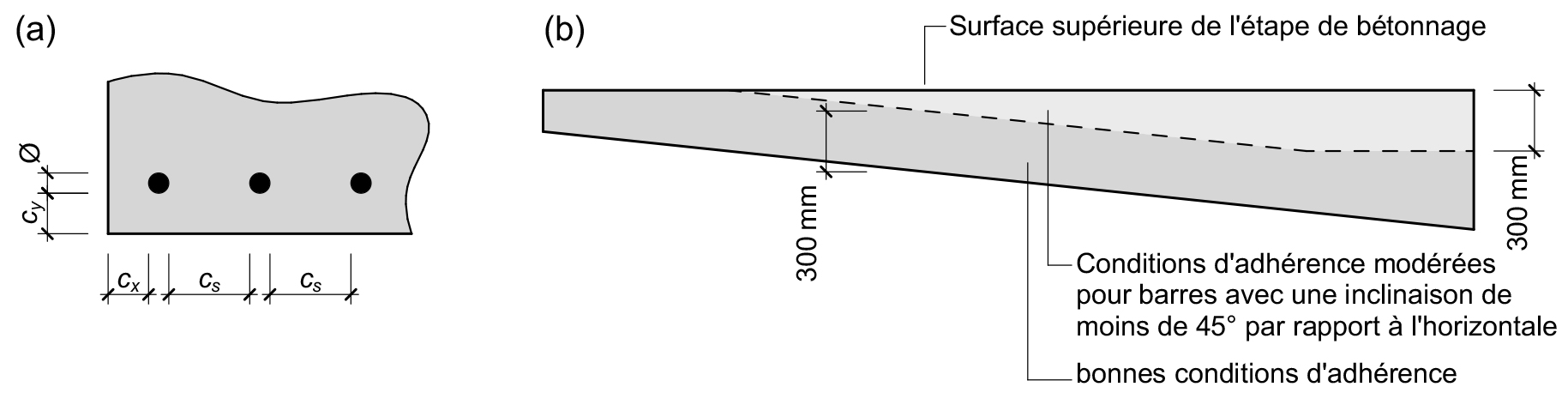Kabinett der Abstrakten
Sichtbeton, gefärbt
Den dritten Bauabschnitt des Sprengel-Museums entwarfen Marcel Meili, Markus Peter Architekten als Erweiterung und Gegenpol des postmodernen Bestandsbaus. Mit ihrem ornamentalen Relief und subtilen Räumen knüpfen sie an ein vielfältiges Repertoire der Schweizer Architektur an.
Für den dritten Bauabschnitt des Sprengel-Museums wurde 2009/2010 ein Wettbewerb im selektiven Verfahren ausgelobt. Von den 65 eingeladenen Teams konnte das Büro Marcel Meili, Markus Peter aus Zürich den Zuschlag der Jury unter dem Vorsitz von Adolf Krischanitz für sich verbuchen. Doch so sehr das Zusammenspiel von Alt- und Neubau und die innere Organisation überzeugt hatten: Das Preisgericht äusserte ästhetische und finanzielle Bedenken angesichts der ursprünglich vorgesehenen spiegelnd-facettierten Fassade.
Im Verlauf des Jahres 2012 konkretisierte sich die endgültige Gestalt des Erweiterungsbaus, nunmehr als über einem zurückgesetzten und verglasten Sockelgeschoss auskragende und durch einen Reliefraster strukturierte Box aus Sichtbeton (vgl. «Fest und verschieblich»). Auf überzeugende Weise knüpfen Marcel Meili und Markus Peter – es handelt sich um ihren ersten Museumsbau – an die Tradition der Schweizer Museumsarchitektur der 1990er-Jahre, die damals nicht zuletzt einen bewussten Kontrapunkt zu den postmodernen Museen in Deutschland darstellte.
Postmoderne Vorgängerbauten
Während 1992 für die neue schweizerische Museumsarchitektur ein Schlüsseljahr darstellt – eröffnet wurden das Kirchner-Museum in Davos von Gigon/Guyer, die Sammlung Goetz von Herzog & de Meuron in München und die Stiftung La Congiunta in Giornico von Peter Märkli –, setzte der Boom der deutschen Museumsarchitektur eine Dekade früher ein. 1982 wurde Hans Holleins Museum Abteiberg in Mönchengladbach fertiggestellt, 1984 Oswald Mathias Ungers’ Deutsches Architekturmuseum in Frankfurt sowie James Stirlings Erweiterung der Stuttgarter Staatsgalerie, 1986 das Museum Ludwig von Busmann & Haberer in Köln.
Den Bauten der 1980er-Jahre, die für den Siegeszug der Postmoderne in Deutschland stehen, gingen vereinzelte Vorläufer voraus, darunter als wichtigster der 1974 eröffnete erste Bauabschnitt des Sprengel-Museums in Hannover. Bernhard Sprengel, Erbe des ortsansässigen Schokoladenkonzerns, hatte der Stadt Hannover seine auf die klassische Moderne konzentrierte Kunstsammlung geschenkt – unter der Bedingung, dass die Stadt ein neues Museum errichte.
Dafür wurde ein exponiertes Grundstück an der Nordostecke des Maschsees gewählt, eines im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsprogrammen 1934/1935 zu Beginn der Nazi-Diktatur angelegten künstlichen Sees, der eine der wichtigsten Freizeitattraktionen den Stadt darstellt. Während heutige Sammler gern auf die autonome Präsentation ihrer Kollektionen drängen, gelang es in Hannover, die exquisite Sprengel-Sammlung mit den das 20. Jahrhundert betreffenden Kunstsammlungen der Stadt und des Lands Niedersachsen zu vereinen.
Ein Museum, drei Bauabschnitte
Als Resultat eines internationalen Wettbewerbs im Jahr 1972, an dem sich auch eine Reihe Schweizer Architekten wie Otto Glaus, Theo Hotz oder André Studer beteiligte, erhielt die Arbeitsgemeinschaft von Peter und Ursula Trint und Dieter Quast den Zuschlag. Das «Kunstmuseum Hannover mit Sammlung Sprengel» wurde 1984 anlässlich des 85. Geburtstags des Mäzens in «Sprengel-Museum» umbenannt.
Mit der Verschmelzung von Innen und Aussen ist der Museumsbau eher ein Produkt der 1970er-Jahre als ein Vertreter der Postmoderne: Das Pflaster des Vorplatzes zieht sich den Hügel hinauf bis hin zum Foyer, erstreckt sich in den Skulpturenhof und findet seine Fortsetzung in der tief gelegenen Museumsstrasse, die als eigentliche Erschliessungsachse des Museums fungiert. Sie verbindet die verschiedenen Ausstellungsbereiche und schafft Orientierung in einer labyrinthisch anmutenden Raumstruktur.
Die weitgehend künstlich belichteten Säle und Kabinette, zum Teil mit Teppichboden ausgelegt, wurden 1989–1992 in einem zweiten Bauabschnitt ergänzt durch eine Sequenz von Oberlichtsälen und ein unterirdisches Auditorium. Der 2015 fertiggestellte dritte Abschnitt war schon im ursprünglichen Wettbewerb von 1972 vorgesehen.
Box für die Konstruktivisten
Als die Fassadengerüste des Neubaus wegfielen, stiess die Optik der Erweiterung zunächst auf Ablehnung, wie Leserbriefe in der Lokalzeitung belegen. Sichtbeton hat in Deutschland ein negativeres Image als in der Schweiz, der dunkle Farbton tat ein Übriges dazu, dass das Verdikt vom «Sarkophag» oder «Brikett» aufkam. Dabei erdet ja der dunkle Farbton das Gebäude und lässt die Längsfassade mit ihren 75 m kürzer erscheinen, als sie in Wirklichkeit ist. Das durch dreierlei Wandstärken erzeugte Fassadenrelief besteht aus sich überlagernden bandartigen Strukturen. Vertikale und horizontale Elemente sind zu einer umlaufenden Textur zusammengeführt; diese rhythmisiert die Oberfläche, gliedert sie in silbrig schimmernde und verschattete Flächen und öffnet ein vielfältiges Referenzspektrum.
Fassadenreliefs gehören zum klassischen Repertoire der Baugeschichte und finden sich in verschiedener Gestalt über Jahrtausende in diversen Kulturen. Das Relief in Hannover zeichnet sich dadurch aus, dass es weder die Tektonik noch den Kräfteverlauf zum Ausdruck bringt, sondern als freies Spiel orthogonaler Elemente verstanden werden kann. In diesem Sinn handelt es sich um ein Ornament ohne semantische Dimension, im Geist des gleichwohl viel strengeren Reliefs an der Brandwand der Schweizerischen Botschaft in Berlin von Helmut Federle.
Das Relief könnte aber auch als Hommage an den Konstruktivismus der 1920er-Jahre interpretiert werden, der im Sprengel-Museum stark vertreten ist. Eines der grandiosen Werke ist die Rekonstruktion von El Lissitzkys «Kabinett der Abstrakten», einem konstruktivistischen, durch die Besucher zu verändernden Museumsraum. (Das Originalwerk wurde 1928 im Provinzialmuseum, dem heutigen Niedersächsischen Landesmuseum, eröffnet und 1937 im Rahmen der von den Nationalsozialisten initiierten «Entartete Kunst»-Aktion zerstört.)
«Das Kunstmuseum, das ich mir erträume»
Der Neubau überzeugt als Endpunkt und intelligent balancierter Gegenpol zum Bestandsbau von Trint/Quast. An diesen anzuschliessen stellte die eigentliche Herausforderung dar. Eine Böschung aus Pflastersteinen am Maschseeufer bildet den fortifikatorisch anmutenden Sockel, der für die reliefierte Box nun wie eine Fermate wirkt. Innen verzahnt ein grosser geschossübergreifender Saal, in dem ein Mobile von Calder aufgehängt werden soll, Alt- und Neubau.
Mit zusätzlichen 1400 m2 ist die Gesamtausstellungsfläche des Museums auf 7000 m2 gewachsen. Während sich Werkstätten und Archive in den beiden Sockelgeschossen befinden, besteht die Hauptebene aus zehn «tanzenden Räumen» – ein seit dem Wettbewerbsentwurf unverändertes Konzept von Marcel Meili, Markus Peter für die Ausstellungsflächen. Die einzelnen Säle variieren in ihren Proportionen, sie wechseln hinsichtlich ihrer Grundrissfläche, Ausrichtung und Raumhöhe und werden stets über die Diagonale erschlossen.
Die Apparaturen hinter den Lichtdecken erlauben es, natürliches und künstliches Licht zu mischen, wobei die «Störung» durch temporäre Wolken nicht herausgefiltert wird, um den Eindruck steriler Artifizialität zu vermeiden. Graue Terrazzoböden, weisse Wände und Lichtdecken tragen zum räumlichen Kontinuum der Säle bei, die jedoch aufgrund der wechselnden Gestalt jeweils ihre Eigenart besitzen und behalten. All die Unterschiede werden beim flüchtigen Besuch vielleicht gar nicht augenscheinlich und offensichtlich, aber sie beleben die Raumstruktur auf subtile Art.
Bereits mit dem Kirchner-Museum in Davos und später mit dem Museum Liner Appenzell knüpften Gigon/Guyer an die Postulate von Rémi Zaugg an, die er 1987 in «Das Kunstmuseum, das ich mir erträume, oder: Der Ort des Werkes und des Menschen» formulierte. Viele seiner Gedanken haben nun in Hannover Widerhall gefunden: Auch Marcel Meili, Markus Peter setzen auf klare, zur Konzentration einladende Säle mit Lichtdecken und weissen Wänden; auch sie vermeiden Enfiladen und Erschliessungen in der Mitte der Wände; und schliesslich öffnen auch sie das Museum visuell nach aussen, um den Ort der Kunst mit dem alltäglichen Leben zu verbinden.
An drei Stellen unterbrechen Loggien den Rundgang: Die Aussenhaut ist hier taschenartig nach innen gezogen, sodass die mit grossen Scheiben und Sitzgelegenheiten versehenen Räume auch atmosphärisch eher dem Aussenraum als dem Kunstparcours zuzuordnen sind.
Von den Stirnseiten, aber auch von der Mitte der Längsseite aus fällt der Blick auf den Maschsee mit seinen Spaziergängern und Segelbooten. Kunst und Alltag miteinander in Beziehung zu setzen war schon der Wunsch von Trint/Quast; es ist spannend und aufschlussreich festzustellen, zu welcher anderen architektonischen Lösung Marcel Meili und Markus Peter aus heutiger Perspektive gelangt sind.