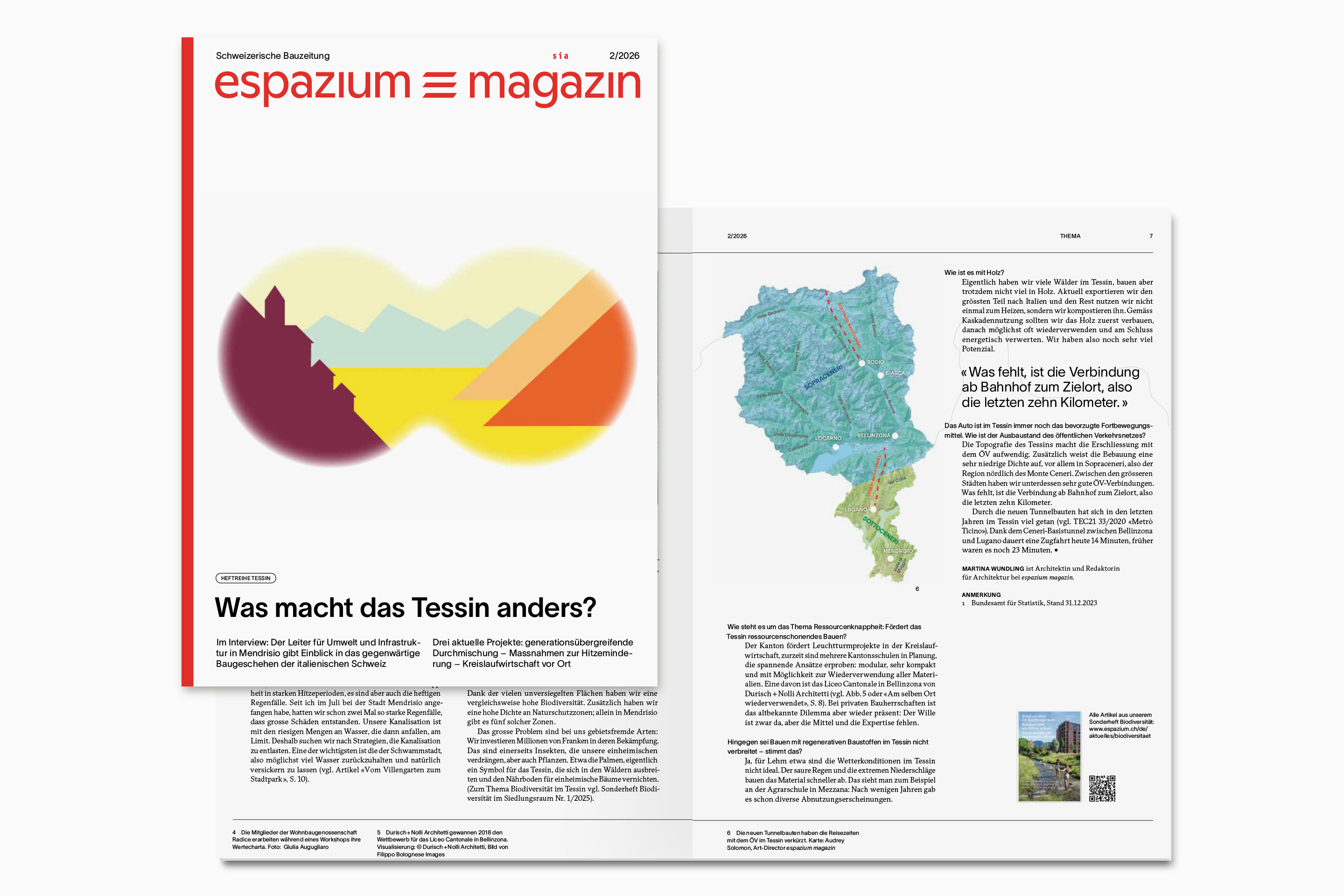«Die Hindernisse sind in den Köpfen»
Das Institut Architektur der FHNW widmet sich aktuell unter dem Titel «In Between» den Agglomerationsräumen. Die Studierenden des ersten Semesters analysierten die dort weit verbreitete Wohnform des Einfamilienhauses in Bezug auf Schwachstellen und Stärken und entwarfen Möglichkeiten der Innenverdichtung im Bestand. Interview mit Prof. Friederike Kluge.
Salome Bessenich: Frau Kluge, Einfamilienhausarchitektur geniesst ja nicht gerade einen herausragenden Ruf, abgesehen von einzelnen Ikonen. Wieso wählten Sie dennoch dieses Thema aus?
Friederike Kluge: Ich bin als Architektin immer wieder mit Einfamilienhäusern konfrontiert, die unternutzt und gleichzeitig schwierig gebaut sind. Ich dachte immer wieder, dass man schon beim Bau in den 1960er- und 1970er-Jahren an eine mögliche Veränderung hätte denken müssen, aber das wurde nicht gemacht. Irgendwann wurde mir klar, dass das eben kein Nebenschauplatz ist, sondern angesichts der Klimakrise zu einer zentralen Frage wird: Wie gehen wir mit den Einfamilienhäusern um?
Wie gingen Sie vor, was war die Aufgabenstellung?
Wir starteten mit der Analyse von Einfamilienhaus-Ikonen wie Lina Bo Bardis Casa de Vidro oder Adolf Loos’ Villa Müller und entwickelten eine Beurteilungsmatrix. Wir schauten die Konstruktion an, aber auch den Bezug zum Aussenraum, zur Strasse, Nutzflächeneffizienz und Hindernisfreiheit. Im nächsten Schritt mussten sich die Studierenden ein Einfamilienhaus aus ihrem Umfeld aussuchen, das sie entlang derselben Matrix beurteilten. Und zuletzt sollten sie mögliche Eingriffe konkretisieren, mit denen diese Häuser so umgebaut werden könnten, dass sie flexibel auf sich ändernde Nutzungsszenarien mit maximal 35 m² pro Person reagieren könnten.
35 m² Wohnfläche pro Person, das ist wohl deutlich unter dem Durchschnitt bei Einfamilienhäusern?
Ja, das ist deutlich weniger, das zeigte auch die Analyse der Studierenden: Teilweise wohnten Personen alleine auf 200 m². Da bietet sich ein riesiges Potenzial im Bestand, das viel besser aktiviert werden könnte. Viele ältere Menschen wollen gar nicht alleine in einem Haus wohnen, bräuchten eine separate Wohneinheit für eine Pflegekraft oder würden den arbeitsintensiven Garten, der für junge Familien besonders attraktiv ist, gerne abgeben.
Was waren das für Häuser, die sich die Studierenden aussuchten?
Das waren ganz gewöhnliche Gebäude, wir wollten unsere Fragestellung der Nutzungsverdichtung anhand einer alltäglichen Architektur erproben. Die meisten Einfamilienhäuser entstanden ja nicht im Rahmen einer sorgfältigen Planung. Einzige Bedingung war, dass die Studierenden nicht selbst darin wohnten.
Welche Erkenntnisse brachte die Analyse dieser Einfamilienhäuser?
Dass tatsächlich kein einziges dieser 50 Häuser im aktuellen Zustand hindernisfrei bewohnbar ist, hat mich überrascht. Das war natürlich eine zufällige Selektion, aber dennoch. Es zeigt, dass eben nicht nur die Nutzflächeneffizienz der Häuser mit zunehmendem Alter aus dem Lot kommt, sondern die Häuser den Bedürfnissen auch aus der Perspektive der Nutzenden nicht mehr gerecht werden. Und da könnte man ansetzen, um beide Probleme zu verbessern.
Wie sind Sie an die Frage der Barrierefreiheit herangegangen?
Die Aufgabenstellung war sehr offen: Maximal 35 m² pro Person und mindestens eine Wohneinheit sollte hindernisfrei funktionieren. Das Erdgeschoss bietet sich dafür an, bei einer Hanglage eventuell auch ein oberes Geschoss über eine neue Erschliessung. Tatsächlich kamen fast alle Projekte letztlich ohne einen Aufzug aus.
Welche Lösungen haben die Studierenden vorgeschlagen, was waren Herausforderungen?
Erschliessung und Treppen sind immer eine Herausforderung, aber das ist alles lösbar. Die Hindernisse sind in den Köpfen. Architektonisch war alles Mögliche dabei: Viele Aufstockungen und kleinere Anbauten, einige haben aber auch nur im Innern eingegriffen, anders unterteilt, Schlafzimmer hinzugefügt oder unternutzte Flächen wie Dachstöcke und Keller für Wohnen oder gemeinschaftliche Räume aktiviert.
Haben die Studierenden ihre Ideen auch den Hausbesitzenden präsentiert? Wie kamen diese an?
Es war zwar nicht Teil der Aufgabenstellung, aber wir haben sie alle ermutigt, ihre Modelle und Pläne zurück in die Häuser zu tragen. Und es gab auch tatsächlich Eigentümerschaften, die ganz konkret sagten, sie wollen etwas verändern und es helfe ihnen weiter. Weil sie bislang dachten, sie müssten ausziehen, und nun sehen, dass es noch eine Reihe anderer Lösungen gibt. Das ist natürlich der Idealfall, wenn so ein Projekt Hausbesitzenden Perspektiven eröffnet. Das zeigt: Das Interesse an einer Veränderung wäre durchaus da.
Welche Erkenntnisse nehmen Sie persönlich aus den Projekten der Studierenden mit?
Für mich hat das Semester bestätigt, welch enormes Potenzial in unserem Einfamilienhausbestand schlummert und was für eine spannende architektonische Fragestellung diese Aufgabe mit sich bringt. Und dass auch die unspektakulärsten Einfamilienhäuschen mit einem Umbau zu neuem Leben erweckt werden können.
Mehr zum Thema in TEC21 11/2025: Zukunft Einfamilienhaus