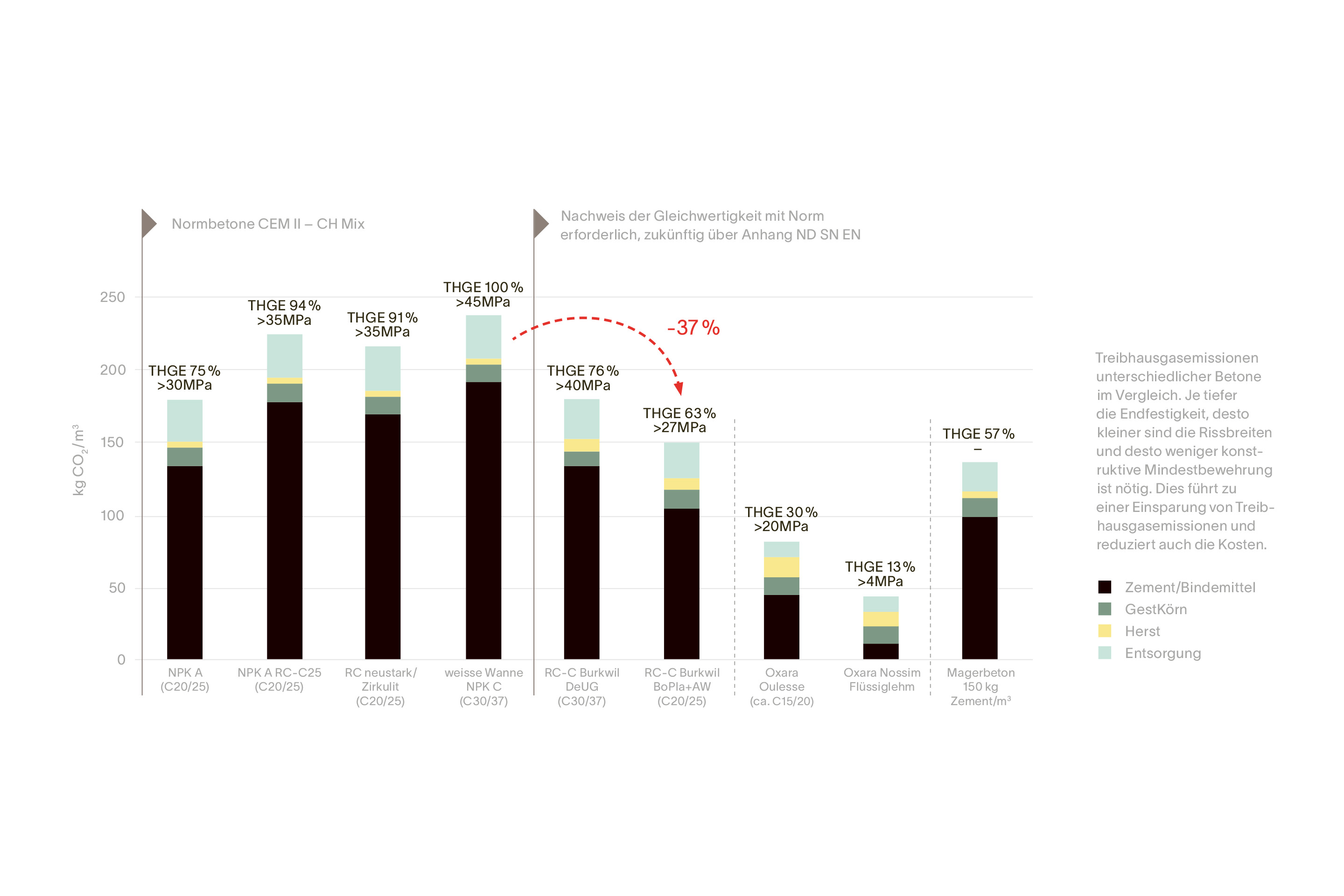«Nur der Gebrauch stabilisiert ein Gebäude – physisch, sozial und ökonomisch»
Transformation, Bauen im Bestand und lernende Planung
Auf dem Pfaff-Areal im deutschen Kaiserslautern wurden einst Nähmaschinen hergestellt. Seit der Verlagerung der Produktion nach Asien wird das Gelände mit seinen Industriebauten nur sporadisch genutzt. Der Verein Kulturwerk Pfaff und das Fachgebiet «Stadt und Architektur» der RPTU Kaiserslautern-Landau versuchen aktuell, dem Bestand eine Perspektive jenseits der vorgesehenen Investorenarchitektur zu geben. Ein Inputreferat von Ben Pohl, Urban Designer und Stadtforscher bei der Denkstatt in Basel, zeigte Ende Juli, wie dies gelingen kann.
Was Sulzer für Winterthur ist, das ist PFAFF für Kaiserslautern: Gut 20 Hektar grosse Industrieareale, ehemals weltweite Produktion und als einst bedeutender Arbeitgeber mitten in der Stadt ein Teil der städtischen Identität. Doch nach der Aufgabe der Industriestandorte befinden sich die beiden Areale in einem völlig unterschiedlichen Entwicklungsstand. Während die Umnutzung des Sulzer Areals Schritt für Schritt voranschritt und sich dort über die Zeit immer neue Pionierprojekte etablierten, steht Kaiserslautern nach einer bewegten Geschichte noch mitten im Prozess der Transformation.
Aktuell befindet sich das Gebiet an einem Punkt, an dem es gelingen könnte, identitätsstiftende Pionierprojekte in die Realisierung zu bringen. Was ist in der jetzigen Phase entscheidend? Welche Chancen bestehen in strukturschwache Stadtregionen? Ein Gespräch über inspirierende Projekte, Kreativität aufgrund fehlender Ressourcen und den richtigen Zeitpunkt, um das Richtige zu tun.
Dr. Susanne Frank: Ben Pohl, Sie arbeiten mit transformativer Stadtentwicklung und engagieren sich für den Gebrauchsschutz. Was ist Ihr Verständnis von Bestand?
Ben Pohl: Aus architektonischer und ingenieurstechnischer Perspektive wird der Bestand aktuell aus zwei Blickwinkeln betrachtet: Der eine erkennt den Bestand als vornehmlich materielle Ressource für eine zukünftig zirkuläre Bauwirtschaft. Der Bestand wird als sogenannte urbane Mine verstanden, Verbrauch von primären Ressourcen und Energie sollen so verringert werden.
Der zweite Ansatz fokussiert den Bestand als Objekt für Umbau. Das ist die Perspektive mit der die Architektur, aber auch die Denkmalpflege, den Bestand als Objekt für bauliche Transformation, Schutzobjekt oder Identitätsanker verstehen.
Insbesondere bei der Denkstatt verfolgen wir einen dritten Blickwinkel, der den Bestand vor allem über seine Nutzungs- und Gebrauchsbeziehungen versteht, als Zusammenhang von Gebäuden, Menschen, Nutzungen, Narrativen, Eigentums- und Finanzierungsstrukturen. Denn vielfach zeigt sich Bestandserhalt in erster Linie nicht als bauliche, sondern als eine organisationale Frage.
«Bestandserhalt ist nicht in erster Linie eine bauliche, sondern eine organisationale Frage»
Was das bedeutet, lässt sich gut an Gebäuden zeigen, die aus ihrer Funktion fallen: Verliert ein Gebäude seine ursprüngliche Nutzung, zerfallen ja nicht gleich die physischen Strukturen – diese sind vielfach in ihrem Gebrauchswert noch gut erhalten. Was obsolet wird, sind die Gebrauchsbeziehungen. Was sich also auflöst ist der Handlungszusammenhang aus physischer Materie, Menschen, ökonomischen Prozessen und Narrativen. Etwa beim Pfaff-Areal hier in Kaiserslautern: Die Nähmaschinen, die hier hergestellt wurden, werden jetzt woanders auf der Welt produziert. Die Menschen, die an diesem Ort beschäftigt waren, aber auch die Dinge, die Maschinen und die Erzählung «Pfaff in Lautern» lösen sich von den Gebäuden ab. Damit wird auch die Beziehung von Boden und Gebäuden fragil. Der Boden wird dann zur Ware, die Gebäude darauf werden zu einer Last, etwa weil sie neuen imaginären Nutzungen scheinbar im Weg stehen oder Altlasten vorhanden sind.
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass sich beim nachhaltigen Umgang mit dem Bestand zunächst weniger eine bauliche Frage stellt als eine organisatorische: Welche neuen Nutzungen lassen sich finden, damit die Gebäude erhalten und geschützt werden können? Damit man weiss, was und wie man umbauen oder renovieren soll, muss man zuerst Menschen, Finanzierungs- und Organisationsmodelle neu versammeln, die Gebäude also durch neue Gebrauchsbeziehungen schützen. Nur durch den Gebrauch kann ich ein Gebäude auch ökonomisch nachhaltig stabilisieren.
Eine Ihrer Methoden ist die lernende Planung. Was bedeutet das?
Bei der Suche nach neuem Gebrauch für alten Bestand wird deutlich, dass die klassischen Planungslogiken aus Zielsetzung, Analyse des Problems, Umsetzung und Kontrolle nicht richtig greifen. Bei lernender Planung geht es daher darum, im Umgang mit dem Bestand offen zu sein für Unbestimmtheiten, potenzielle Nutzer:innen, unbekannte Finanzierungs- und Organisationsmodelle und neue Narrative. Das bedeutet, sich ein Planungsverständnis anzueignen, dass den Bestand in seinem erweiterten Sinn als Chance und Aushandlung begreift.
Das ist zum einen die Aushandlung mit den Gebäuden. Was ist technisch, planungsrechtlich, statisch oder typologisch sinnvoll, vor allem in Bezug zur Eingriffstiefe und nötigen Investitionen? Zum anderen ist es eine Frage an das Potenzial der Menschen am Ort. Welche Nutzungsinteressen, welches Knowhow bringen sie mit? Das lässt sich oft am besten im 1:1-Modell herausfinden, so wie es die Zwischennutzung mit der alten Pfaff-Mensa aktuell versucht. Wichtig ist aber, dass man nicht bei der Zwischennutzung stehen bleibt, bei der alle nach drei Jahren wieder gehen müssen, sondern dass diese Nutzungen als Beginn einer «lernenden Planung» verstanden werden, die den Weg für ein neues Nutzungskapitel der Gebäude aufzeigen.
Konkret am Beispiel des Pfaff-Areals in Kaiserslautern gefragt: Es gibt hier eine breite Unterstützung, Bürgerinnen und Studierende, die sich engagieren, auch die Stadt ist durchaus offen – wie bringt man nun die Stakeholder in einen produktiven Prozess bis zur Realisierung?
Man darf nicht hoffen, dass es jemand anderes – die Stadt oder ein freundlicher Investor. – für einen löst. Man muss das selbst machen. In unseren Projekten suchen wir immer nach Menschen, die konkret am Ort etwas machen wollen: Eine Kita eröffnen, einen Indoor-Spielplatz organisieren, einen Klub betreiben, eine Brauerei, eine Schmiede und so weiter. Dadurch findet man die Menschen, die nachher den konkreten Ort in Gebrauch nehmen und ihn produktiv und ökonomisch stabilisieren. Man erkennt sehr schnell, wer sich ernsthaft interessiert, welche konkreten Raumbedarfe und Anforderungen es gibt, welche Baustandards reichen, welche Mieten sich diese Akteure leisten können. Damit beginnt sich ein Netz von praktischem Wissen und von Möglichkeiten zu knüpfen, mit dem man sehr präzise planen kann – baulich, aber auch ökonomisch.
Wir vermeiden es dabei bewusst, die Menschen nach ihren Wünschen zu befragen. Das führt zu Erwartungshaltungen, die meist nicht realisierbar sind, was dann Frustration zu Folge hat. Wir fragen aber danach, was jemand machen will und welche Verantwortung sie oder er übernehmen kann. Sind Macher:innen, der Ort und das Narrativ beisammen, findet man in der Regel auch eine Finanzierung, sei es durch gemeinsames Eigenkapital, Stiftungen oder Förderungen.
Warum sollte eine Stadt wie Kaiserslautern sich auf einen solchen auch aufwendigen und eventuell unsicheren Prozess einlassen? Was ist der Mehrwert für die Stadt?
Der Prozess ist gar nicht so aufwendig und unsicher, wie es scheint. Er gaukelt nur nicht vor, man wisse zu Beginn schon alles und brauche nur Investoren. Für Kaiserslautern wäre es ein Gewinn, selbsttragende zivilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen, die gemeinnützige Immobilienentwicklung leisten können und Orte wie die Pfaff-Mensa transformieren und betreiben – ohne dauerhaft von Subventionen abhängig zu sein.
Konkret geht es darum, dass man Nutzungen, bauliche Investitionen und Gemeinwohlökonomie im Zusammenhang begreift. Was können interessierte potenziellen Mieter:innen/Nutzer:innen an Miete zahlen? Was können sie im Selbstausbau leisten, wieviel Kapital braucht es, um den minimalen Standard für neuen Gebrauch herzustellen, welches Eigenkapital muss beschafft werden, z.B. über Anteilscheine an einer Genossenschaft oder Kleinkredite? Welche Förderungen gibt es für die Anschubfinanzierung und den Umbau? Wie sichere ich das Gemeinwohl dauerhaft ab?
«Ein Baurechtsvertrag gibt allen Seiten Sicherheit»
Auch die Stadt kann viel tun, auch ohne grosse finanzielle Spielräume. Ein Baurechtsvertrag gibt allen Seiten Sicherheit. Die Stadt kann darin Bedingungen vereinbaren, etwa die Verpflichtung, Kultur und quartierdienliches Gewerbe anzusiedeln, und zwar zur reinen Kostenmiete, also ohne private Rendite zu erwirtschaften. Zugleich erhält die Stadt dauerhaft Einnahmen aus dem Baurechtszins und muss dafür nicht mal ihren Boden verkaufen, in 99 Jahren kann sie wieder neu entscheiden. Wenn die Stadt hingegen das Areal an einen Investor verkauft, hat sie kaum noch Zugriff.
Einnahmen aus Baurechtszins könnten zudem ein nachhaltiges Finanzierungsmodell für die Stadt werden, vor allem in strukturschwachen Regionen, wo der Boden günstig ist. Ein Szenario wäre: Immer, wenn ein Gebäude auf den Markt kommt, versucht die Stadt es zu kaufen. Sie behält den Boden und gibt das Gebäude wieder in den Markt, aber knüpft über den Baurechtsvertrag Verpflichtungen daran, etwa die Gebäude nicht leer stehen zu lassen und als Spekulationsobjekte zu nutzen, obwohl z.B. Wohnungen fehlen. Die Stadt hätte laufende Einnahmen, die mit dem Bodenwert steigen, und würde sich Gestaltungsspielräume erarbeiten.
«Wichtig ist, alles, was an Aktivitäten möglich ist, an den Ort zu holen»
Vorausgesetzt, alle Seiten sind sich einig, ein Baurechtsvertrag ist möglich – wie gelingt es, die Gebäude niederschwellig in eine Nutzung zu überführen?
Gelingt es der Initiative, genügend Kultur- und Gewerbenutzer:innen und Eigenkapital zu beschaffen und die Stadt zu überzeugen, dann kann sie den Umbau Schritt für Schritt angehen. Man repariert erst einmal nur das Nötigste, nimmt den Bau provisorisch in Gebrauch und erzielt eine kleine Miete. Wichtig ist, alles, was an Aktivitäten möglich ist, an den Ort zu holen: Die Pioniernutzungen, die Planungssitzungen, die Beteiligungsprozesse, die Feste, die Politik etc. Diese Nutzungen funktionieren als 1:1-Modell und bringen Erkenntnisse zu Ort, Akteuren und Gebrauch, die aus dem entfernten Büro schlechter zu erkennen sind.
Parallel entwickelt man nun mit den künftigen Mieter:innen und professionellen Planer:innen die Bestellung an die Architektur. Auch hier gibt es tolle Beispiele wie so etwas aussehen kann, etwa bei der Genossenschaft Warmbächli in Bern. Die Initiative würde sich also in eine Bauherrin verwandeln und hätte partizipativ auszuhandeln wie das Alltagswissen der Nutzer:innen und potenziellen Mieter:innen und das Planungswissen der Architektur zusammenkommen. Vielleicht ist die Hochschule involviert, die vor Ort eine Bauhütte hat und mit Planungsknowhow beiträgt. Die architektonische Aufgabe definiert sich dann nicht über die Idee, das Objekt oder das Material, sondern aus den Gebrauchsbeziehungen und über das Wissen der Akteure am Ort.
Die Kompetenzen dafür gibt es in Deutschland auch in der Region Kaiserslautern, z.B. via Montag Stiftungen, Triodos Bank oder Mietshäusersyndikat. Gemeinwohlmodelle können auch die Stadt als Stakeholder mit einbeziehen, z.B. als Public Civic Partnership Modelle1, wie sie in einigen Städten in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt wurden. Damit könnte langfristig auch ein «Modell Kaiserslautern» entstehen, das über das einzelne Objekt hinaus eine neue Perspektive in die Stadtentwicklung für strukturschwache Regionen gibt.
Das Gespräch führte Dr. Susanne Frank, Fachbereich Architektur, Fachgebiet «Stadt und Architektur», Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau RPTU
Transformation Pfaff-Areal, Kaiserslautern
Der Nähmaschinenhersteller Pfaff prägte von 1862 bis 2009 die rheinland-pfälzische Stadt Kaiserslautern: Die Firma baute ganze Stadtteile, Bäder und Kinderkrippen, war über Jahrzehnte der grösste Arbeitgeber der Region und Dreh- und Angelpunkt im Leben vieler Menschen. Doch der Strukturwandel ab den 1990er-Jahren sorgte zunächst für die Verlagerung der Produktion und führte 2009 zur definitiven Stilllegung des 20 ha grossen innerstädtischen Areals.
Im Rahmen des seit den 2000-Jahren laufenden Insolvenzverfahrens legte die hochverschuldete Stadt Kaiserslautern 2007 die Verantwortung für die Fläche in die Hände lokaler, politiknaher Investoren. Dies sorgte für Unmut in der Bevölkerung und machte auch den Rechnungshof des Bundeslands Rheinland-Pfalz auf das Pfaff-Areal aufmerksam.
Dieser befürchtete, dass die Entwicklung des Gebiets durch einen einzelnen Investor am Ende zu Lasten der öffentlichen Hand geht. Dennoch flossen Fördermittel von etwa 90 Millionen Euro in die Entwicklung des Gebiets. Die Voraussetzung: Die Stadt sollte die Flächen von den privaten Investoren zurückkaufen und ein nachhaltiges Konzept für einen neuen Stadtteil gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickeln.
Dafür gründete man 2014 eine städtische Entwicklungsgesellschaft, die einen Rahmenplan, einen Bebauungsplan, ein Gestaltungshandbuch und ein aufwendiges Bewerbungsverfahren für die einzelnen Baufelder entwickeln liess. Ein unabhängiger Vermarktungsbeirat wurde gegründet, um Konzepte der Investoren objektiv bewerten und die Ziele der Stadt im Auge zu behalten zu können. Der entwickelte Rahmenplan machte Hoffnung auf einen neuen, für Kaiserslautern wichtigen Stadtteil. Zudem sah er Raum für kulturelle Zwecke auf dem Areal vor.
Hier kommt das Kulturwerkpfaff e.V. ins Spiel: Der 2017 gegründete Verein ist ein Zusammenschluss kunst- und kulturaffiner Initiativen, Vereine und Menschen aus Kaiserslautern und Umgebung. Er setzt sich für den Erhalt der verbliebenen Bauwerke ein, für eine dauerhafte Ansiedlung der Kunst- und Kulturszene auf dem alten Pfaff-Areal und die Stärkung der generationsübergreifenden Gemeinschaft. Belohnt wurde dieses Engagement mit einem zweijährigen Zwischenmietrecht für die alte Betriebskantine
Der Verein würde gerne Fördermittel beantragen, um die Kantine instand zu setzen und als Ort für die Kunst- und Kulturszene zu etablieren. Das kann er aber nicht, solange er nicht seitens der Stadt als Eigentümer bzw. Pächter der alten Kantine definiert wird (oder einen Investor findet, mit dem er das Projekt entwickeln könnte). Die Stadt wird die Kantine nicht los, möchte sie aber auch nicht aus der Vermarktung nehmen. Immerhin, Ende Mai hat sich der Stadtrat mit grosser Mehrheit dafür ausgesprochen, die ehemalige Kantine zukünftig als soziokulturelles Zentrum zu nutzen.
Anmerkung
1 Public-Civic-Partnership Neue Formen der koproduzierten Stadt am Beispiel Haus der Statistik, Berlin. PLANERIN, Mitgliederfachzeitschrift für Stadt-, Regional- und Landesplanung 02/2022