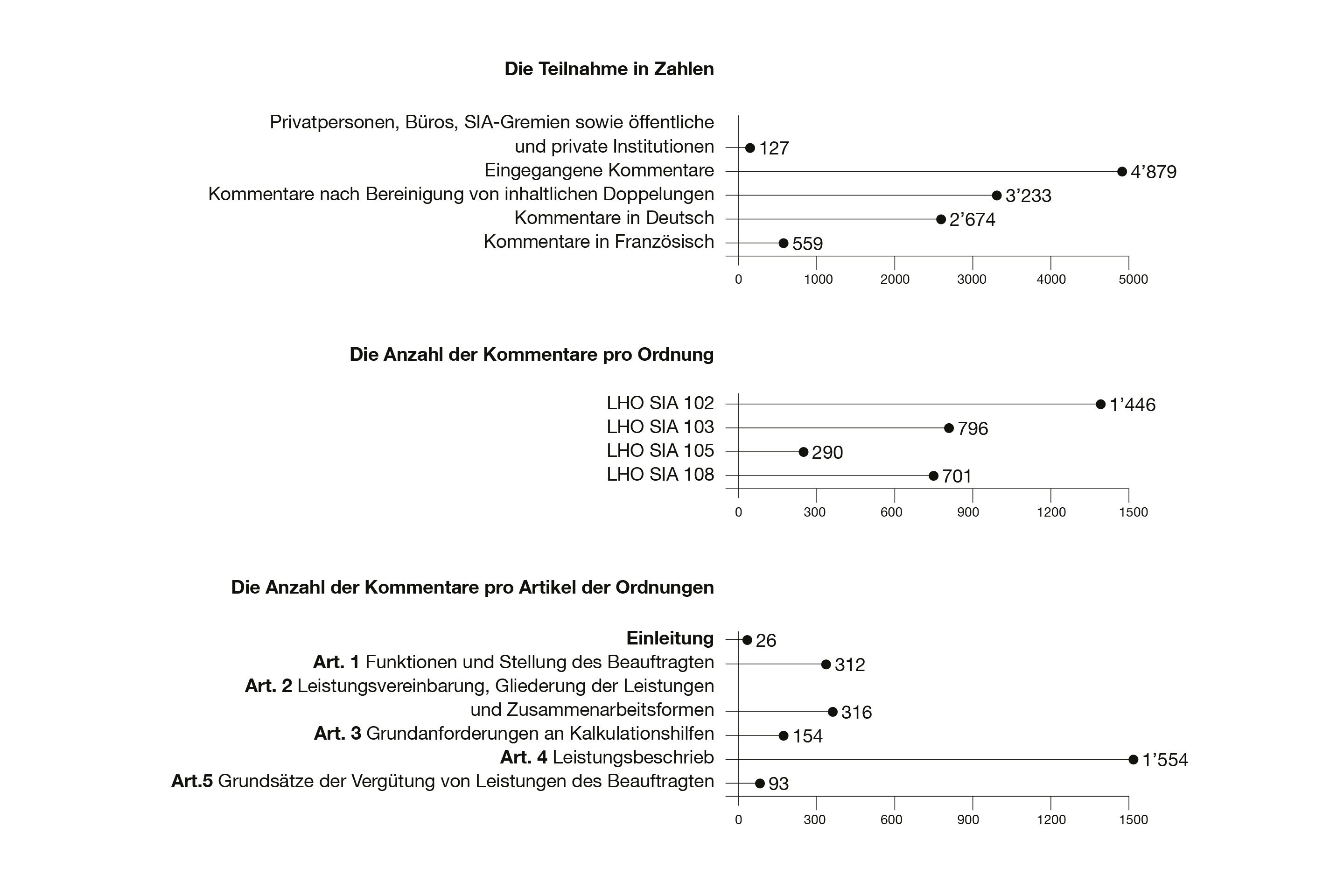Projektallianzen: Alle Partner ins Boot holen
Die Zusammenarbeit in einer Projektallianz setzt einen intensiven Dialog in der Startphase voraus. Dass sich das lohnt, davon sind Birgitta Schock und Laurindo Lietha, Vorstandsmitglieder des Vereins pro-allianz.ch, überzeugt.
«In einer Projektallianz verfolgen alle Beteiligten ein gemeinsam definiertes Ziel, partikuläre Interessen stehen im Hintergrund. Das ist der Grundsatz», beschreibt Birgitta Schock, Vizepräsidentin des SIA, das Wesen einer Projektallianz.
Mitte Juni dieses Jahres haben die Trägerverbände SIA, suisse.ing und der schweizerische Baumeisterverband (SBV) den Verein pro-allianz.ch – Verein zur Förderung von Projektallianzen gegründet, in dessen Vorstand Birgitta Schock sitzt. Seit beinahe 20 Jahren befasst sie sich mit dem Zusammenarbeitsmodell der Projektallianz.
Vizepräsident des Vereins ist Laurindo Lietha, Verantwortlicher Beschaffungswesen im SIA. Der studierte Architekt und Bauökonom sah diese Organisationsform bereits vor zehn Jahren als Chance für die Planungsbranche. «Dass es so schnell konkret wird, habe ich allerdings nicht erwartet», gibt er zu.
Tatsächlich hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan: Der SIA hat im Merkblatt SIA 2065 Planen und Bauen in Projektallianzen die Grundsätze für die Abwicklung von Projektallianzen festgehalten und damit die normativen Grundlagen für dieses Zusammenarbeitsmodell geschaffen. Zudem hat er mit dem Broker AIC Schweiz eine Versicherungslösung für Allianzprojekte bereitgestellt und auch den Vertragsentwurf für die Umsetzung von Projektallianzen erarbeitet.
Mit pro-allianz.ch soll nun der Sprung in die Praxis gelingen: Der Verein fördert Projektallianzen gemäss dem Merkblatt SIA 2065 und will diese Organisationsform in der Schweizer Bau- und Planungsbranche weiter bekannt machen.
Kollektives Kopfzerbrechen
Die Anforderungen an die gebaute Umwelt können bisweilen zu Kopfzerbrechen führen. Das Bauen wird immer komplexer, Ressourcen werden knapper und die soziale sowie ökologische Verantwortung von Planenden grösser. Insbesondere öffentliche Bauvorhaben verfügen über eine Komplexität und ein Risikopotenzial, das häufig nur noch schwer handhabbar ist.
«Das führt dazu, dass diese Projekte oftmals viel teurer werden und länger dauern als geplant. Dann wird es Zeit, neue Wege auszuprobieren», führt Lietha aus: «Es braucht also dynamischere Prozesse. Eine Projektallianz macht diese möglich.» Auch Schock ist überzeugt: «Diese Anforderungen können wir nur gemeinsam lösen.»
In einer Projektallianz sind die Eigeninteressen der beteiligten Parteien mit den Projektinteressen gleichgesetzt. Die Akteure tragen die Verantwortlichkeiten partnerschaftlich und erarbeiten Lösungen frühzeitig im Dialog. Sie steuern Risiken gemeinsam, die Erfolgsvergütung erfolgt dabei anreizbasiert und erfolgsabhängig. Schock spricht von einem Paradigmenwechsel, der mit diesem Zusammenarbeitsmodell einhergeht.
Lietha erläutert das mit einem Blick in die Geschichte: «In den vergangenen Jahrzehnten lebten wir unter dem Credo von Einzelleistungen und Spezialisierungen. Das hat heute auch zu einem gewissen Turmbau zu Babel geführt. Mit den Projektallianzen liefern wir einen Baustein zu einem Kulturwandel zurück zur integralen Zusammenarbeit.»
Für Schock ist klar, dass dieser Weg nur mit einem grossen Engagement aller Beteiligten gegangen werden kann. Sie nennt als Voraussetzung dafür die Bereitschaft, eigenes Wissen weiterzugeben und es nicht als Eigenkapital zu verstehen: «Dabei ist die Integration von Wissen, das normalerweise zu späteren Zeitpunkten des Prozesses gemacht wird, in frühen Phasen wichtig.» Und es brauche die Bereitschaft, Teams auszuwechseln, falls sie nicht auf das gemeinsame Ziel hinarbeiten.
Mehr Ko-Kreation
Der Verein pro-allianz.ch thematisiert dieses Verständnis. Er formuliert als eine von drei Voraussetzungen für Projektallianzen die Bereitschaft zu einem grundlegenden Kulturwandel verbunden mit einem neuen Rollenverständnis in Bezug auf gemeinsame Planung und Realisierung des Projekts. Lietha greift diesen Punkt auf: «Wer in einer Projektallianz arbeitet, ist Ko-Kreateur beziehungsweise Ko-Kreateurin. Das gilt für alle Beteiligten: Bestellerinnen, Planende und Unternehmer.»
Nicht vergessen dürfe man auch die Gestaltungsmöglichkeiten, die das Zusammenarbeitsmodell für die Bauherrschaft biete: «Die Bauherrschaft sitzt mit am Tisch – sie arbeitet auf Augenhöhe am Projekt und wirkt an den Entscheiden mit. Das ist bei traditionellen Modellen nicht in dieser direkten Form möglich», ergänzt er.
Dialog in der Startphase
Die Zusammenarbeit in Projektallianzen setzt also Flexibilität, Transparenz und eine neue Wertekultur voraus – Bauherrschaften, Planende und Realisierungspartner müssen sich gemeinsam auf neue Prozesse einlassen. Das scheint anspruchsvoll. Schock und Lietha sind jedoch überzeugt, dass sich dieser Prozess lohnt.
«Die Zusammenarbeit in Projektallianzen spart viel Zeit, Nerven und Kosten», betont Schock. Vielleicht nicht am Anfang, da müsse viel verhandelt werden. Doch das gehe in einer frühen Phase einfacher als zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das Streitpotenzial grösser sei. Für Schock ist klar: «Je später im Prozess Diskussionen geführt werden, die im schlechtesten Fall zu einem Gerichtsfall führen, desto teurer wird es. Und desto geringer sind die Einflussmöglichkeiten für Anpassungen.»
Auch als Mittel gegen den Fachkräftemangel werden Projektallianzen oftmals aufgeführt, denn die Zusammenarbeit in Allianzen schafft Anreize für die Mitarbeitenden: «Sie haben Spass an der Arbeit und können ihre Kompetenzen zu einem frühen Zeitpunkt in das Projekt einbringen. So erzeugt ihr Einsatz Wirkung», ist Schock überzeugt. Wenn das Ziel interessant genug sei – auch wirtschaftlich – würden sich die Projektbeteiligten sehr schnell dorthin bewegen. Die Partner seien motiviert, nach dem Prinzip «Best for project» zu arbeiten, und das bedeute schlussendlich ein geringeres Risiko für das Projekt. «Deshalb ist auch die ganze Beschaffung der Teammitglieder höchst relevant», ergänzt Lietha.
Bei ersten Beschaffungen kommt heute das neuartige Instrument des Dialogs zum Einsatz. Dieses ist auch im Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen verankert. «Es wird interessant, wenn die ersten Bauherrschaften vorgelagert einen Wettbewerb schalten oder versuchen über einen Studienauftrag zu beschaffen», blickt Lietha in die Zukunft, «alle Optionen sind gegenwärtig denkbar.»
Phase der Konstituierung
Der Verein pro-allianz.ch befindet sich aktuell in einer Phase der Konstituierung. Im Zentrum seiner Tätigkeit steht der Wissensaustausch, die Weiterentwicklung des Merkblatts SIA 2065 und die Erarbeitung von Grundlagen für die Aus- und Weiterbildung.
Lietha sieht grosse Chancen im neuen Verein: «Die Aufgabe des SIA ist es, die normativen Grundlagen zu legen. Mit dem neuen Verein pro-allianz.ch haben wir die Möglichkeit, alle Partner ins Boot zu holen, die an dieser neuen Welt mitbauen wollen.» Wenn es der Verein schaffe, eine Handvoll Projekte anzustossen und die Logik der Projektallianzen in der Bau- und Planungsbranche bekannter zu machen, dann sei ein erster wichtiger Schritt getan, sind sich Lietha und Schock einig.
Weitere Informationen: pro-allianz.ch