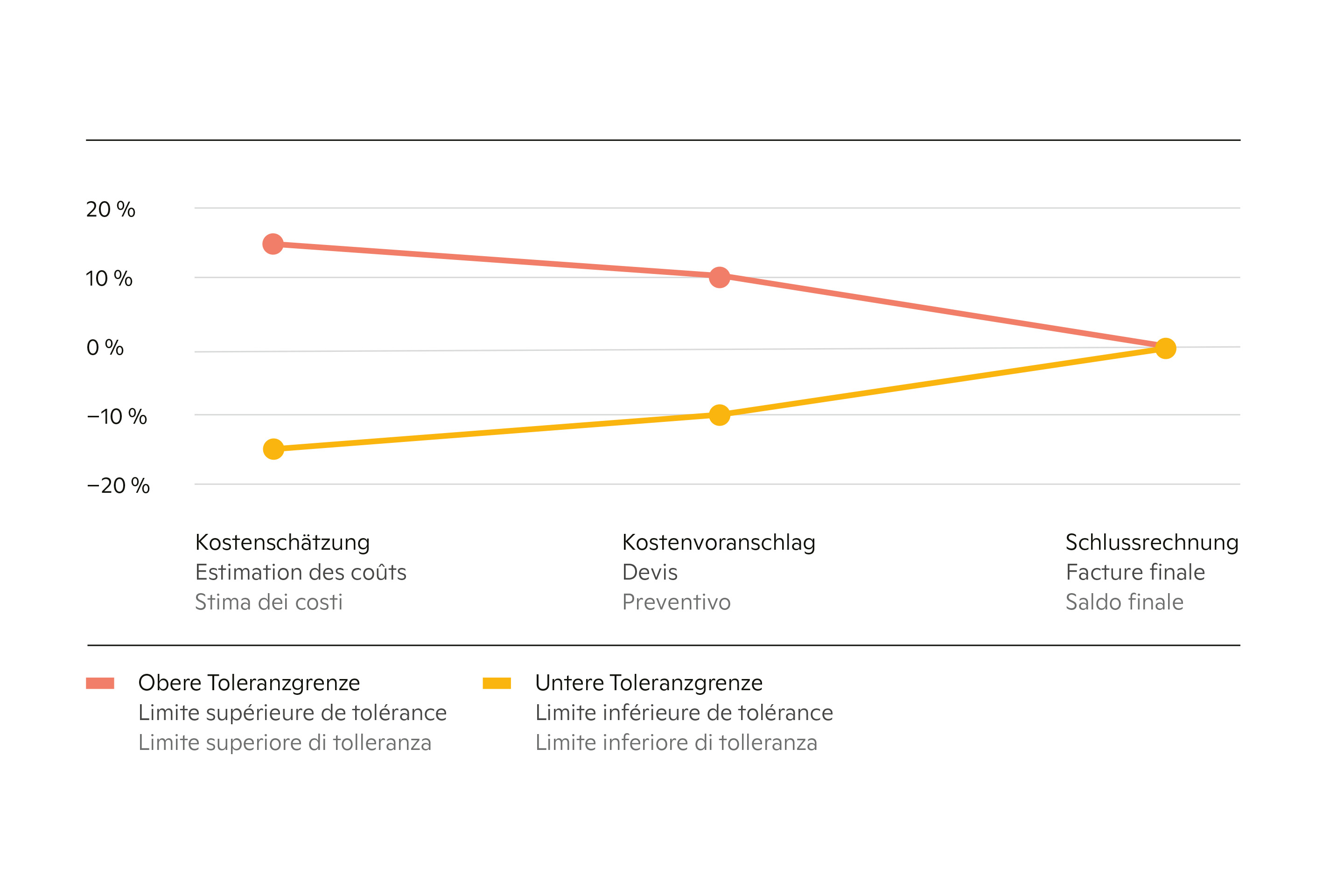Spirituosen in Holz
In Appenzell haben Traditionen Bestand – auch, weil sie immer wieder erneuert werden. Das Familienunternehmen Appenzeller Alpenbitter stellt seit bald 125 Jahren mitten im Ort den gleichnamigen Kräuterlikör her und überraschte nun mit sensiblen Erweiterungsbauten.
Das seit 1908 bestehende Familienunternehmen Appenzeller Alpenbitter hat sich kontinuierlich rund alle 20 Jahre vergrössert. Weil das Unternehmen inzwischen auf etwa 40 Mitarbeitende angewachsen ist, war ein Neubau nötig. Bisher verteilte sich der Betrieb auf acht Häuser und externe Lager. Besonders prägnant ist ein Kubus von 2006, dessen gelbe Fassade an gelben Enzian, die Hauptzutat des berühmten Bitters, erinnern soll. Weil diese Produktionsstätte zunehmend unter bauphysikalischen Mängeln litt, legte man beim Neubauprojekt besonderen Wert auf sorgfältige Planung und robuste Materialien.
Für die Planung eines Hochregallagers und die Erweiterung der Bürogebäude lud das Unternehmen 2019 fünf Architekturbüros zu einem Wettbewerb ein. Die neuen Gebäude sollten, genau wie das Unternehmen, Ressourcen aus der direkten Umgebung innovativ verwenden und die Architektur somit gleichzeitig zur Werbefläche werden.
Ergänzung als Beruhigung
Lukas Imhof Architektur aus Zürich schlug in einem integralen Ansatz vor, den Neubau und die bestehenden Gebäude zu einer Einheit zusammenzufassen. Den Ausgangspunkt dafür bildet ein neues Hochregallager auf der Ostseite des Geländes, das einen neuen Zugang und eine neue Anfahrt bietet. Auf externe Lager kann in Zukunft verzichtet werden und die Transportwege verkürzen sich. Ein Viadukt begrenzt das Grundstück und die frühere Rückseite wird zur Schauseite für Bahnreisende.
Entlang der Längsseite des Gebäudekomplexes bildet eine Reihe historischer Wohnhäuser das Gegenüber. In ihrer Kleinteiligkeit setzen sie eine andere Massstäblichkeit, auf den die Neubauten reagieren, ohne dabei ihre gewerbliche Funktion zu leugnen.
In einem zweiten Schritt werden 2026 die bestehenden Lager und Büros aufgestockt. Sie führen das traditionelle Motiv der Satteldächer weiter, die vom niedrigsten Baukörper im Westen bis zum Neubau im Osten stufenweise in die Höhe wachsen, bis sie an das angeschlossene Hochregallager angrenzen.
Das Spiel mit dem Massstab
Das bereits in Betrieb genommene Hochregallager umschliesst ein imposantes Volumen von gut 26 000 m3. Die Öffnung zum Bahnviadukt und die Anpassung an die topografische Lage gliedern die kurze Seite. Lieferantinnen, Selbstabholer und Speditionen nähern sich dem Komplex von dort, während Mitarbeitende und Besuch weiterhin von der Westseite kommen.
Markant ist die vollständige Ummantelung des Lagers mit Holzschindeln in Anlehnung an den traditionellen Wetterschutz der Häuser in der Region. Entsprechend den Dimensionen des Gebäudes ist das Format der Schindeln grösser als üblich und ihre Verlegeart trägt seinem industriellen Charakter Rechnung: Die Fichtenbretter von 15 cm x 75 cm sind als überlappende horizontale Bänder angeordnet. Die Hülle umschliesst auf der Südseite die in die Fassade versetzten Stützen und auf der Nordseite die aussenliegende vertikale Entwässerung mit sanften Aufwölbungen. Ein Detail, das sich in kleinem Massstab an den benachbarten Wohnhäusern wiederfindet.
➔ Weitere Beiträge zum Thema Holzbau finden Sie in unserem digitalen Dossier.
Im Innern
Die Holzkonstruktion steht auf einer Betonbodenplatte und kommt mit nur einer dezentral angeordneten Stützenreihe aus, was eine flexible Nutzung garantiert. Die Böden der 9 m hohen Regale aus Massivholz sind 10 cm stark und an den Vorderkanten mit einer Buchenholzleiste geschützt. So kann schwere Ware per Hubstapler auf Paletten gehoben werden.
Als Lager für hochprozentigen Alkohol unterliegt der Bau strengen Brandschutzauflagen. Die Ausbildung als offener Brandabschnitt fordert ein objektspezifisches Konzept, das die Planenden in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden erarbeitet haben. Die wichtigsten Massnahmen umfassen die Installation einer Sprinkleranlage und die Trennung der Regalgassen. Ausserdem darf Alkohol nur auf einer Höhe von maximal 7.5 m gelagert werden. Eine raumhohe und 6 cm starke Dreischichtplatte zwischen den Regalflächen soll den Brandüberschlag verhindern. Ausserdem ist der Raum durchgängig auf maximal 21 °C heruntergekühlt, um Explosionen zu verhindern. Dadurch steigt allerdings der Energiebedarf deutlich.
Ganzheitliches Denken
Dem hohen Energieaufwand für die Kühlung stehen energetische Überlegungen beim Bau gegenüber. Einige davon sind unkonventionell. So hat man beispielsweise die Speichermasse der Flüssigkeit in den gelagerten Flaschen in die Berechnung der Speichermasse des Gebäudes einbezogen. Aber auch naheliegende Lösungen wie PV-Anlagen auf dem Dach des Neubaus und des gelben Kubus’ wurden umgesetzt.
Der eigene Wald als Ressource
Den grössten Beitrag zur positiven Ökobilanz leistet allerdings die Verwendung von Holz als Baumaterial. Der Familienbetrieb ist der grösste Privatwaldbesitzer im Kanton Appenzell, sodass man für den Neubau 2500 m3 Rundholz aus eigenen Wäldern verwenden konnte. Kurze Wege zur Baustelle und zum Sägewerk im Kloster Magdenau garantierten einen geringen CO2-Abdruck. Zum Einsatz kamen astfreie Weisstannen und Fichten für die Fassade und den Innenraum sowie astiges Material im Dreischichtholz für die Binder und die Regale.
Von der Entscheidung für einen nachhaltigen Bauprozess, der Verwendung regionaler Materialien und der Veränderung der Betriebsabläufe profitiert nicht nur das Image des Unternehmens, sondern auch die Region. Nicht zuletzt ist der Duft von Kräutern und Holz, der das Hochregallager erfüllt, ein überzeugender Hinweis auf die vorherrschenden Werte.
Erweiterung Produktionsanlage Appenzeller Alpenbitter, Appenzell
Bauherrschaft
EECO Immobilien, Appenzell
Architektur
Lukas Imhof Architektur, Zürich
Baumanagement/ Bauleitung/ Bauingenieurwesen
B3 Brühwiler, Gossau (SG)
Holzbauingenieurwesen/ Brandschutzplanung
B3 Kolb, Romanshorn
Elektroplanung
Elektro Schwizer, Appenzell
HLKS-Planung
Instaplan, Oberbüren
Bauphysik
Studer + Strauss, St. Gallen
Holzbau
holzin, Appenzell
Baumeister
appenzellerbau, Stein (AR)
Fenster
Ego Kiefer, St. Gallen
Lieferung Binder
Hüsser Holzleimbau, Bremgarten
Lieferung Blockholz
Pius Schuler, Rothenthurm
Volumen
26 000 m3
Fertigstellung
1. Etappe: 2025
2. Etappe: 2026