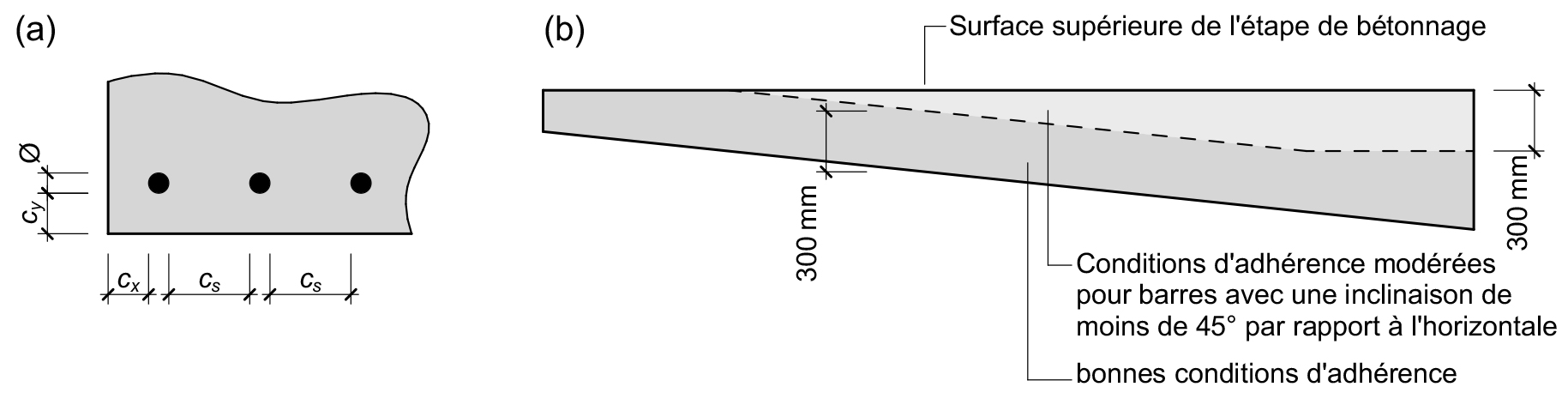Mehr (als) Durchfluss
Begrenzter Raum, eine immense Ereigniswucht, kurze Vorlaufzeiten, schwierige Prognosen, hohe Kosten und zuweilen ein fehlender Konsens: Das ist Hochwasserschutz in alpinen Gegenden. Es braucht Ausdauer, gute Ideen, Geld und leider auch manchmal – gegen das Vergessen – eine Katastrophe.
Zu Beginn etwas Positives: Die schweizerischen Gefahrenkarten kann man als absolutes Erfolgsmodell ansehen. Noch nie war es für Planer so einfach, einem Eigentümer zu sagen, sein Objekt stehe am falschen Platz. Ob Wasser aus Flüssen, Bächen oder Seen, Murgänge, Sturzprozesse oder Lawinen – für praktisch jede Siedlung und jeden Verkehrsweg zeigen die Karten auf, welche Gefährdungen zugrunde liegen, in welcher Gefahrenzone sich ein Objekt befindet oder – bei Intensitätskarten – mit welchen Intensitäten zu rechnen ist.
Müssen die Gefahrenkarten mit ihren verschiedenen Zonen in der Raum- und Nutzungsplanung Berücksichtigung finden, dienen Intensitätskarten als Grundlage für die Notfallplanung und die Umsetzung technischer Massnahmen. Mittlerweile existiert sogar eine Gefährdungskarte für Oberflächenabflüsse – das Regenwasser, das direkt auf dem Boden und nicht in einem Gerinne abfliesst. Diese hat allerdings keinen rechtsverbindlichen Charakter. Selbst für nicht besiedelte Gebiete existieren teilweise sogenannte Gefahrenhinweiskarten. Diese beruhen auf grob basierten Modellrechnungen oder auch auf Beobachtungen bei oder nach Extremereignissen. Hochwasserspuren etwa lassen sich anhand von Geschwemmsel glaubwürdig nachvollziehen.
Hochwasser? Gab es hier noch nie …
Zu glauben, mit dem Aufzeigen der vorhandenen Gefahr oder einer Risikoabschätzung wäre die Begründung des Hochwasserschutzes schon erledigt, stellt sich allerdings oft als Trugschluss heraus. Gerade nach einigen Jahren ohne Ereignis wiegen sich die Menschen sehr schnell in vermeintlicher Sicherheit.
Je nach Region gehen die systematischen Abflussaufzeichnungen etwa 100 Jahre zurück. Vorher existieren oftmals nur einzelne Hochwassermarken oder Zeitzeugenberichte von Überschwemmungen. Betrachtet man die Datengrundlage, fällt auf, dass die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts eine relativ ruhige und trockene Periode repräsentierte. Sehr grosse Ereignisse, wie etwa die Extremhochwasser 1999 oder 2005, blieben aus. Daher war die Wucht dieser Ereignisse sogar für Fachleute überraschend.
Hochwasser 1999 und 2005 rütteln auf
Die Hochwasserereignisse der Jahre 1999 und 2005 waren einschneidend. Beiden Ereignissen lag die berüchtigte Vb-Wetterlage zugrunde. Die Gebietsniederschläge 2005 zeigen anhand ihres Ausmasses genau das Bild dieser wassergesättigten Luftströmung, die von Österreich und Bayern kommend in die Schweizer Alpen hineinzog.
Obwalden bekam davon seinen Teil ab. Hier fielen die höchsten 5-Tages-Gebietsniederschläge der gesamten Schweiz. Waren in vielen Gegenden der Schweiz die gemessenen Abflussspitzen 1999 höher als die sechs Jahre später, verhielt es sich an der Sarneraa umgekehrt. 148 m3/s im Jahr 2005 standen 61 m3/s im Jahr 1999 gegenüber. Schweizweit gesehen nahmen die Schäden 2005 das bisher grösste Ausmass an: Sechs Todesopfer waren hierzulande zu beklagen und 3 Milliarden Franken an Sachschaden1 – 250 Millionen Franken davon allein in Obwalden (Bafu, Eidg. Forschungsanstalt WSL: Ereignisanalyse Hochwasser 2005, Bern 2007).
Überlastbarkeit integral bewältigen
Diese Grossereignisse führten in der Schweiz und auch im übrigen Alpenraum zu einem wachsenden Bewusstsein gegenüber der Gefährdung, ja geradezu zu einem Erwachen aus einer gewissen Lethargie. Hochwasserschutzprojekte wurden aufgegleist, umgesetzt und bereits angelaufene Planungen anhand der Erfahrungen aus den Katastrophen geprüft und überdacht. Bei den baulichen Massnahmen ist seither die Überlastbarkeit der Systeme mit das Wichtigste. Die Planer dimensionieren ein Bauwerk nicht mehr nur auf einen bestimmten Abfluss bezeihungsweise ein bestimmtes Szenario, sondern betrachten und simulieren heutzutage auch die Folgen einer Überschreitung der Bemessungsgrundlage.
Was passiert etwa, wenn ein Flussdamm überströmt wird? Muss man ihn darauf auslegen, oder reicht eine kontrollierte Entlastungsstelle, und wie wird mit dem austretenden Wasser verfahren? Bekommt man dieses kontrolliert in den Griff, etwa durch Ableitung oder Retention, ergibt dies robuste Systeme. Der Grossteil des Abflusses verbleibt im Gerinne, und die technischen Massnahmen funktionieren weiterhin. Schäden im Überlastfall können zwar auftreten, werden aber bedeutend weniger Auswirkungen haben. Beispiele für solche Überlastbauten wären etwa die Entlastungsstelle Hänggelgiessen am Linthwerk oder die Entlastung der Engelberger Aa in Buochs.
Jedoch nicht nur die baulichen Massnahmen bekamen von diesen Katastrophen Aufwind, auch die Gefahrenprävention, das Risikomanagement und die Notfallplanungen wurden überdacht und verbessert. Manch eine Gemeinde hat für viele denkbare Szenarien, etwa für ihre einzelnen Wildbäche, nun bereitliegende Notfallplanungen. In geordneter Struktur liegen Abläufe vor, was von den einzelnen Akteuren zu tun ist. Das fängt bei ganz profanen Dingen wie hinterlegten Telefonnummern von Einsatzkräften an, geht aber zu wichtigen Entscheidungshilfen über.
Zu welchem Zeitpunkt wird wer alarmiert, wie kann der Kommandant vor Ort beurteilen, welcher Abfluss kritisch ist, braucht es Dammwachen, wo wird abgesperrt, welche Notfallwege kann man benutzen, wenn eine Strasse ausfällt? Im Hinblick, dass Ereignisse unregelmässig wiederkehren und über Jahre Einsatzkräfte und andere Akteure wechseln, erhält eine solche Notfallplanung ein bedeutendes Gewicht. Sie bedarf allerdings ständiger Anpassung und im besten Fall auch wiederkehrender Übungen. Dieses heute in der Schweiz angewandte integrale Risikomanagement, das zum Ziel hat, alle Phasen und Akteure bei der Ereignisbewältigung miteinzubeziehen, hat viel von den vergangenen Katastrophen gelernt.
Die ausführliche Version dieses Artikels ist erschienen in «TEC21 16/2021 Fluss im Fels, Steine im See».