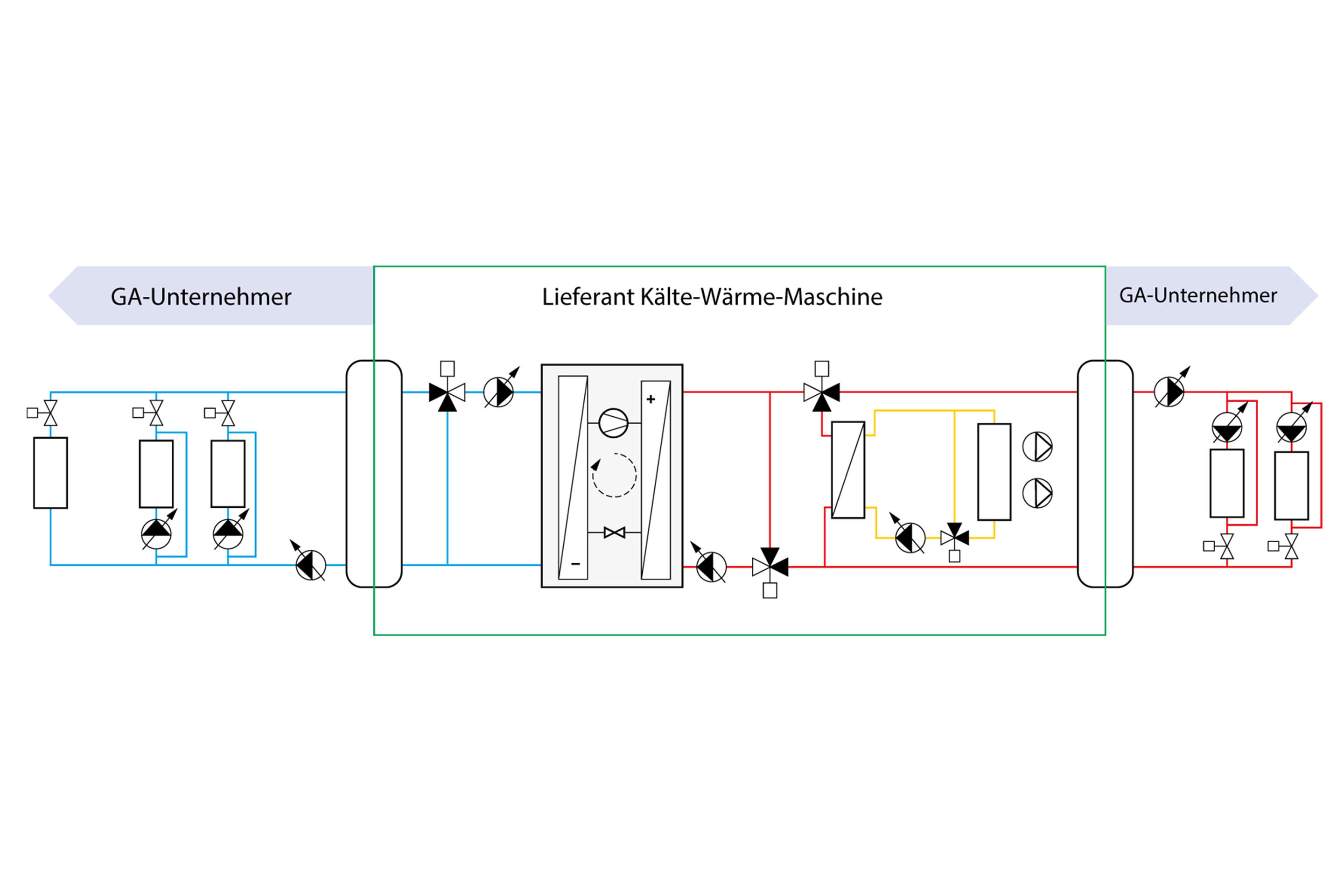Mobilitätsräume im Fokus
Bereits zum zweiten Mal haben Studierende der Fachhochschule Nordwestschweiz «Case Studies für alle» für die Plattform baukulturschweiz.ch erarbeitet. In diesem Jahr fragten sie sich: «Unterwegs im Dazwischen: weniger Verkehr, mehr Baukultur?»
Zwischen Pratteln und Liestal liegt die Rheinstrasse, die die Ortschaften Füllinsdorf und Frenkendorf durchschneidet. Insgesamt zählen die beiden Gemeinden rund 11 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Bevor Ende Dezember 2013 die Autobahn A22 eröffnet wurde, fuhren durchschnittlich 40 000 Fahrzeuge pro Tag über die Rheinstrasse. Heute ist sie dank der 4.5 km langen Umfahrung mit dem Schönthaltunnel vom Durchgangsverkehr entlastet. Doch die neun Tankstellen auf dem Gemeindegebiet zeugen noch von dieser belebten – oder besser befahrenen – Zeit.
Die Schönheit des Schönthals, das zu Füllinsdorf und Frenkendorf gehört, zeigt sich dem Betrachter nur auf den zweiten Blick. Das Gebiet der beiden Gemeinden, ein klassisch suburbaner Raum, ist ein buntes Gemisch aus Einfamilienhäusern an sonnigen Hanglagen, Wohnblocks, Reiheneinfamilienhäusern sowie Einkaufszentren im Tal. Die Rheinstrasse ist geschmückt mit Gewerbezonen. In den 1950er- und 1960er-Jahren wandelte sich das Tal rasant, als es zum Einzugsgebiet der Stadt Basel und der Industrie entlang des Rheins wurde. Besonders die attraktive Ausrichtung, die gute verkehrstechnische Anbindung sowie die fortschreitende Erschliessung trugen dazu bei, dass es sich zu einem gefragten Wohnort für Pendler entwickelte.
Ein Faible für Un-Orte
Die raumplanerische Zukunft des Schönthals wird aktuell in einem partizipativen Entwicklungsprozess der Gemeinden Frenkendorf, Füllinsdorf und Liestal erarbeitet. Doch aus raumplanerischer Sicht war das Schönthal lange ein unterschätzter, unzureichend genutzter, von Strassen und Infrastrukturen geprägter Raum. Ein Raum ganz nach dem Geschmack von Christina Schumacher und Janine Kern; vermeintliche «Un-Orte» haben es ihnen angetan. Die beiden sind Dozentinnen im Fach Sozialwissenschaften am Institut Architektur an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW).
Bereits zum zweiten Mal haben sie ihre Studierenden beauftragt, für die Webplattform baukulturschweiz.ch «Case Studies für alle» zu erarbeiten. Damit wollen sie den jungen Architekturstudierenden das Davos Qualitätssystem für Baukultur näherbringen. Anhand einer konkreten Semesteraufgabe müssen sie sich mit den acht Kriterien für eine hohe Baukultur auseinandersetzen. Dieses Jahr lautete die Aufgabe: «Stop and Go»: Qualitäten suburbaner Mobilitätsräume.
Die Logik der Mobilität
Der Aufgabe liegt die Prämisse zugrunde, dass der Verkehr wesentlich das Gesicht des Dazwischens und den Alltag im suburbanen Raum prägt. Die Logik der Mobilität hat die unterschiedlichsten Orte und Un-Orte hervorgebracht. Manche sind von langer Hand geplant, andere ohne Plan aus dem alltäglichen Gebrauch entstanden. Viele Mobilitätsräume wirken lieblos, ohne Sorgfalt gestaltet, in anderen können Qualitäten entdeckt werden. Die beiden Dozentinnen verstehen unter dem Begriff Mobilitätsraum «ein[en] Ort, der durch den Verkehr geprägt ist und funktionalen Charakter hat.
Auf Anhieb stiftet er keine erkennbare Identität. Er hat seinen Bezug zur Geschichte und den sozialen Eigenschaften mehrheitlich verloren.» Dadurch werden Mobilitätsräume schnell zu vergessenen Zwischenräumen, die flüchtig sind und geprägt von Übergängen und Durchgängen. Als Mobilitätsraum muss auch das Schönthal verstanden werden. Die Strukturveränderungen, die in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts stattgefunden haben, machten aus dem produktionsorientierten Tal einen Ort, an dem man nur schläft – arbeiten tut man woanders.
Eine Aufgabe mit Tücken
Ausgehend von der These «Unterwegs im Dazwischen: weniger Verkehr, mehr Baukultur?» sollten die Studierenden in Frenkendorf oder Füllinsdorf nach einem Raum suchen, der oft genutzt wird, qualitätsvoll oder unwirtlich erscheint. Entschieden haben sie sich unter anderem für eine Hausunterführung, eine Tankstelle, eine Bushaltestelle und den Frenkendorfer Dorfkern. Jeder dieser Orte wurde einer Analyse nach den acht Kriterien für eine hohe Baukultur unterzogen.
Umfangreiche Analyse
Die Studierenden mussten online zu ihrem Raum recherchieren und ihn beobachten. Zudem verlangten Christina Schumacher und Janine Kern, dass sie Nutzerinnen und Nutzer des Mobilitätsraums zu ihrer Sicht darauf befragten. Auf Basis dieser drei Zugänge sollte die Analyse entstehen. Das Tool «Case Studies für alle» auf der Webplattform baukulturschweiz.ch sieht zudem vor, dass jedes Projekt mit einem 30 Sekunden langen Standvideo hinterlegt und mit kurzen Texten zu den acht Kriterien beschrieben wird.
Während der Projektpräsentationen an der FHNW zeigte sich schnell, dass die Aufgabe schwieriger war als vielleicht erwartet. Allen Räumen ist gemein, dass das Kriterium der Funktionalität dominiert und auf Mobilität ausgerichtet ist.
Die Räume erfüllen ihren Zweck, doch findet sich meist kaum Vielfalt. Viele davon sind eher lärmig. Die treffendsten Aussagen zum baukulturellen Kriterium des Genius loci gaben meist die befragten Passantinnen und Passanten. Zu der Hausunterführung meinten sie beispielsweise: «Hier fängt es an, kühl zu werden. Es kommen keine Gefühle auf. Es ist ein toter Ort.»
Raum ohne Sinn
Weil die Rheinstrasse verkehrstechnisch beruhigt worden ist, haben viele der analysierten Mobilitätsräume zu einem gewissen Grad ihren Sinn verloren. Sie erfüllen nur noch bedingt ihre historisch gewachsenen funktionellen und wirtschaftlichen Anforderungen. Viele der Studierenden ertappten sich dabei, intervenieren zu wollen. Janine Kern sagt: «Wir stellen immer wieder fest, dass die Architekturstudierenden schnell etwas Konkretes planen wollen. Dieses Modul schult die Aufmerksamkeit für Bestehendes, ohne darin sofort nach Potenzial für Neues zu suchen.»
Beziehungen schaffen Schönheit
Für viele der Studierenden zeigte sich, dass die Qualität des Raums erst im Zusammenspiel zwischen den verschiedenen baukulturellen Kriterien entsteht. Die meisten der betrachteten Räume sind nicht per se schön. Die Schönheit ergibt sich für die Betrachtenden durch die Beziehungen, die sich eröffnen. So nimmt die Verkäuferin der Tankstelle an der Rheinstrasse diesen Ort als schön war. «Ich arbeite schon seit 15 Jahren hier und kenne die Leute. Für mich hat der Ort Geschichte, weil ich schöne Erlebnisse hier hatte.»
Die Webplattform baukulturschweiz.ch hat ein grosses Interesse daran, dass Case Studies von Studierenden erarbeitet werden. Baukultur geht nicht nur bereits etablierte Fachleute und Entscheidungsträger etwas an, sondern grundsätzlich alle Menschen. Über die Frage, wie wir eigentlich leben wollen, sollte viel häufiger debattiert werden. Die FHNW geht mit gutem Beispiel voran und zeigt, dass Studierende Case Studies verfassen können. Janine Kern ist begeistert vom Tool «Case Studies für alle». «Es ist eine hilfreiche Anleitung, einen Ort genau zu betrachten und zu untersuchen, ohne ihn vorschnell zu bewerten. Manchmal zeigen sich an den vermeintlichen Un-Orten unerwartete Qualitäten», betont sie.
Seit dem 11. Juni sind die neuen Case Studies der FHNW auf baukulturschweiz.ch einsehbar.