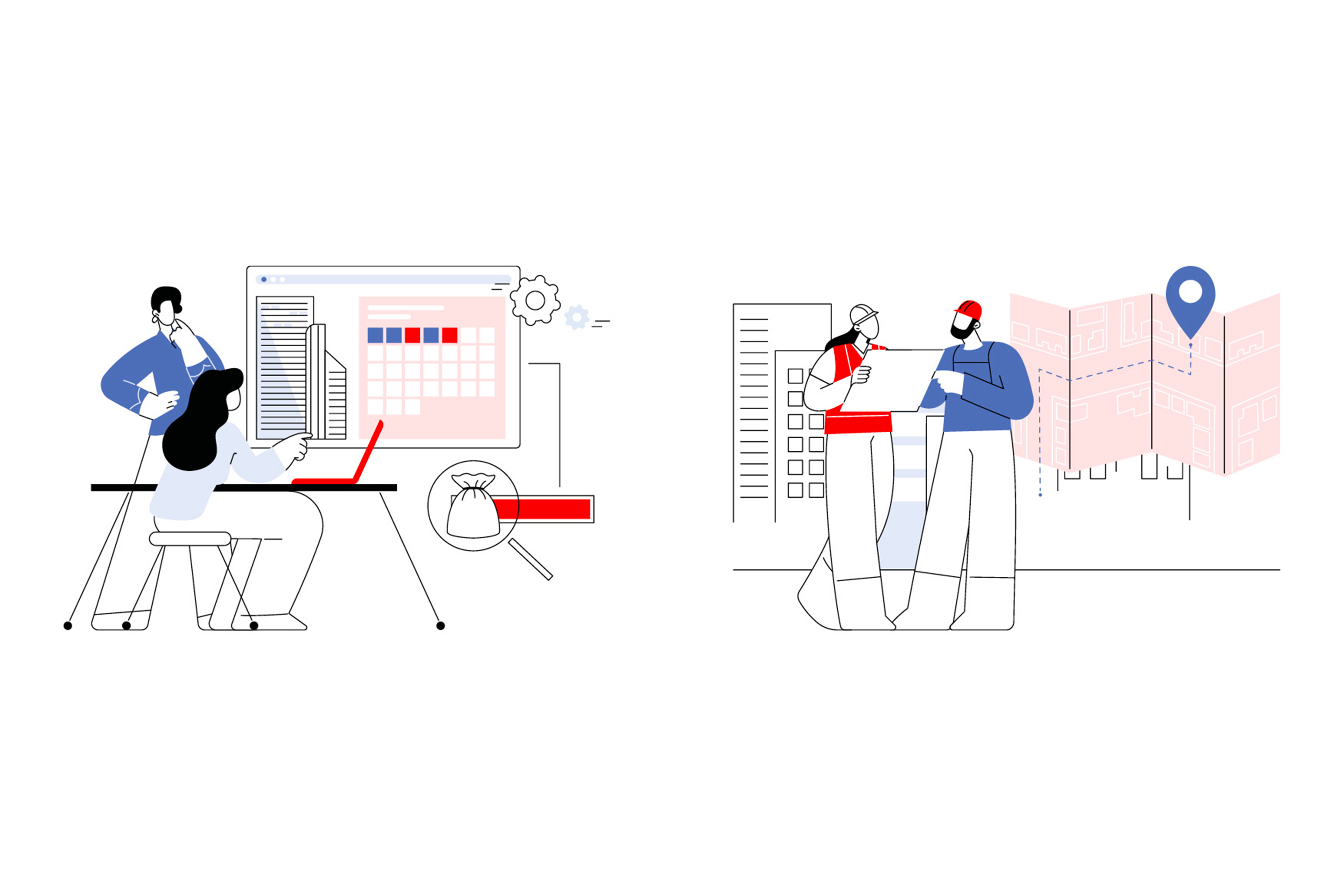Debatte um die Planungshonorare
Vergabewesen
Eine Anpassung der Honorierungsvorgaben durch den Kanton und die Stadt Zürich sorgt für Aufruhr. Was steckt dahinter? Und vor allem: Wie geht es weiter?
Den Architektinnen und Architekten fiel es nicht sogleich auf: Das Hochbauamt des Kantons Zürich und das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich haben ihre Honorierungsvorgaben für Planungsleistungen per Anfang 2025 angepasst. Zunächst blieb es ruhig. Doch nach einigen Wochen sorgte die Sache für wachsende Sorge in der lokalen Architekturszene – und bald auch darüber hinaus.
Zurückindexieren auf 2018
Festgehalten sind die neuen Honorierungsvorgaben im revidierten «Merkblatt zu Planungsaufträgen» des AHB vom Januar 2025 und der Wegleitung «Planerhonorare und Vertragsmodelle» des HBA vom 1. Januar 2025.
Für Beunruhigung unter den Architektinnen und Architekten sorgte vor allem die Berechnung des Schlusshonorars: Die gesamten aufwandbestimmenden Baukosten im Zeitpunkt der Bauabrechnung werden mit dem Zürcher Wohnbauindex ZIW wieder auf das Jahr 2018 zurückindexiert.
Die beiden Bauherrschaften begründen die Neuerung mit der Tatsache, dass die Baukosten im Vergleich zur allgemeinen Teuerung und der Lohnteuerung in den Planungsbüros unverhältnismässig stark gestiegen sind. Um diese zu berücksichtigen, haben sie ihre Stundenansätze erhöht – doch nicht in angemessener Weise, argumentiert die Zürcher Architekturszene.
Problematische Koppelung
Mit der Anpassung ihrer Honorierungsvorgaben rühren Stadt und Kanton an ein Thema, das schon länger für Kontroversen sorgt: Die Koppelung der Planungshonorare an die Baukosten.
Tatsächlich steht dieses Modell auch unter Ingenieuren und Architektinnen schon länger in der Kritik. Moniert wird vor allem, dass ein solcher Ansatz falsche Anreize setze. Planungsfachleute hätten kaum ökonomisches Interesse daran, ihre Arbeitszeit in schlankere Projekte zu investieren, die mit weniger Aushub, Baustoff oder Technik auskommen. Im Gegenteil: Derlei Innovation werde finanziell abgestraft. Zu honorieren sei deshalb nicht die schiere Baumasse, sondern die intellektuelle Leistung für die Planung hochwertiger Bauten.
In jüngster Zeit kommt das Argument hinzu, dass das Modell – wie im Übrigen auch manche technische Norm – ursprünglich vom Neubau her erdacht und deshalb für das Bauen im Bestand nur bedingt adäquat sei. Die Nachhaltigkeitsziele, zu denen sich die Schweiz und der SIA bekennen, und insbesondere das Netto-Null-Ziel erfordern ein Umdenken von der Tabula-Rasa-Mentalität hin zur zirkulären Ökonomie. Doch bei Instandsetzungen, Umnutzungen und Transformationen stehe die Komplexität der Planungsaufgabe oft in keinem Verhältnis zu den Baukosten.
Rückblende 1: LHO-Formel hinterfragt
Hinzu kommen seit einigen Jahren auch juristische Unsicherheiten. 2018 erzwang die Weko den Rückzug des bis dahin geltenden, mit den Baukosten gekoppelten SIA-Zeitaufwandsmodells. Seither gibt es faktisch keine allgemein anerkannten, geschweige denn politisch sanktionierten Honorierungsansätze mehr.
Zur Erinnerung: Bis 2018 ermöglichte die Formel in Artikel 7 des Zeitaufwandmodells der SIA-Lohn- und Honorarordnungen LHO 102, 103, 105 und 108 eine Abschätzung des Stundenaufwands, der mit einer Planungsaufgabe verbunden ist, anhand der Baukosten und weiterer Parameter.
Die Formel stand allerdings in der Kritik der eidgenössischen Wettbewerbskommission Weko (vgl. E-Dossier LHO). 2002 hielt die Weko den SIA dazu an, das damals geltende Kostentarifmodell zurückzuziehen. Die folgende LHO-Revision ersetzte die langjährige Honorarformel durch eine Zeitaufwandformel. Diese kam während rund zehn Jahren zur Anwendung; mit den Honorarempfehlungen der Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren (KBOB) bildete sie eine Orientierungshilfe zur Honorarabschätzung.
Rückblende 2: LHO-Formel zurückgezogen
2015 rügte die Weko den SIA und die KBOB erneut: Sowohl das Zeitaufwandmodell als auch die Honorarempfehlungen würden eine unzulässige Wettbewerbsabrede darstellen. Daraufhin zog die KBOB ihre Honorarempfehlungen per Ende 2017 zurück.
Das Zeitaufwandmodell des SIA blieb vorerst bestehen, bis die Weko Voruntersuchungen zur Kartellrechtskonformität der LHO einleitete. Im November 2018 sah sich der SIA schliesslich gezwungen, die betroffenen LHO neu zu publizieren – ohne die jeweiligen Artikel 7.
Auch wenn sich die Branche noch einige Jahre lang weiterhin an der etablierten Honorierungspraxis orientierte, erodierte dieser Konsens zusehends. Honorare sind heute letztlich Verhandlungssache – was insbesondere für jüngere Büros eine grosse Herausforderung darstellt.
Neues Modell in Arbeit
Seit 2018 arbeitet der SIA daran, wettbewerbsrechtlich legale Praktiken zur Honorarermittlung und -vergütung neu zu definieren. Zusammen mit der ETH Zürich hat er eine Plattform zur Aufwandermittlung entwickelt: Statt Baukosten sollen künftig nachvollziehbare Kriterien im Zusammenhang mit dem spezifischen Projekt den Aufwand bestimmen. Dieser Logik folgt auch die noch laufende Revision der Leistungs- und Honorarordnungen.
Die Markteinführung der Plattform für Architekturleistungen nach SIA 102 soll im August 2025 erfolgen. Dem kamen die Stadt und der Kanton Zürich im Januar 2025 mit ihren angepassten Vorgaben nun zuvor. Und diese könnten, so die Sorge vieler Architekturbüros, landesweit Tatsachen schaffen. Was befürchten sie konkret?
Kritik an den neuen Vorgaben
Im Winter 2025 gründeten 39 Architekturbüros die Arbeitsgruppe AG Honorare, vertreten durch eine Taskforce aus den bekannten Büros pool, Baumberger Stegmeier, neff neumann, EM2N und Graber Pulver.
Am 10. April 2025 wandte sich die Arbeitsgruppe mit einem Schreiben an den Kanton und die Stadt Zürich. Sie kritisierte, dass die revidierten Vorgaben zwei entscheidende Faktoren ausser Acht liessen.
Erstens sei die Anzahl der im Grundhonorar inkludierten Zusatzleistungen stark gestiegen, ohne dass eine entsprechende Korrektur der Honorarfaktoren stattgefunden hätte.
Zweitens habe die Komplexität der Planung in den letzten Jahren zugenommen. Der Wandel der technischen Normen, der gesellschaftlichen Anforderungen und der Auslegungspraxis von Gesetzen sowie neue digitale Prozesse und die Schwierigkeit, teilweise widersprüchliche Behördenvorgaben in Einklang zu bringen, würden einen beträchtlichen Mehraufwand generieren. Dieser sei im Honorar weiterhin nicht abgebildet.
Erstes Gespräch und Aufruf des BSA
Am 3. Juni 2025 fand ein Gespräch zwischen Vertretenden der AG Honorare einerseits und des städtischen Amts für Hochbauten und des kantonalen Hochbauamts anderseits statt. Alexander Huhle, Partner und Mitglied der Geschäftsleitung von Graber Pulver Architekten, war seitens AG Honorare beteiligt. «Konsens herrschte vor allem darin, dass die Sichtweisen komplett unterschiedlich sind», stellt er fest.
Weitere Gespräche hätten Stadt und Kanton nicht ausgeschlossen. «Doch solche Verhandlungen», meint Huhle weiter, «sollen nicht mit der AG Honorare stattfinden, weil diese – auch darin waren sich alle einig – nicht als offizielle Vertretung der Planungsbranche legitimiert sei.»
Harsche Kritik an der Einführung der Rückindexierung der aufwandbestimmenden Baukosten durch Stadt und Kanton Zürich übt auch der BSA Schweiz. Am 16. Juni 2025 alarmierte er seine Mitglieder mit einer Mitteilung und rief sie zur Wachsamkeit auf:
Auch wenn Stadt und Kanton Zürich im Gegenzug zur Rückindexierung der Baukosten ihre Stundenansätze erhöhten, resultiere ein Rückgang des Honorars ab 2025. Und dies, obwohl «unter Berücksichtigung der statistischen Gegebenheiten und einer konservativen Einschätzung der notwendigen Mehrleistungen durch die Planerinnen und Planer das Honorar per Anfang 2025 eigentlich steigen und nicht fallen [müsste]».
Stellungnahme des SIA
Damit ist der Ball wieder beim SIA als massgebendem Berufsverband der Planungsbranche. Er reagierte am 26. Juni 2025 mit einer von der Präsidentin und zwei Vize-Präsidenten unterzeichneten Stellungnahme. Auch deren Ansage zur Zürcher Neuerung ist unmissverständlich: «Diese Änderung […] wird durch den SIA strikt abgelehnt.»
Zwar anerkennt der SIA, dass Bauherrschaften ein legitimes Interesse daran hätten, die Honorierung von Planungsleistungen regelmässig zu überprüfen und allenfalls anzupassen. Doch die gewählte Rückindexierungspraxis fokussiere einseitig auf die aufwandbestimmenden Baukosten und lasse weitere zentrale Komponenten des geltenden Honorarrahmens ausser Acht.
Der SIA bestätigt, dass nicht nur die Baukosten, sondern auch der Planungsaufwand gestiegen sei: «Der SIA kann die deutliche Zunahme der planerischen Komplexität, der regulatorischen Anforderungen und der Lohnkosten seit 2009 nachweisen. Eine Modellanpassung, welche diese Aspekte unberücksichtigt lässt, verkennt die Realität in den Planungsbüros.»
Existenzielle Folgen befürchtet
Lilitt Bollinger, Co-Präsidentin BSA Schweiz, verdeutlicht: «Die einseitige Massnahme berücksichtigt die heutige Arbeitsrealität der Architektinnen und Architekten nicht. In der Essenz ist sie eine Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz von kleinen bis mittelgrossen Architekturbüros.»
Auch der SIA nennt in seiner Stellungnahme «substanzielle Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Grundlagen von Planungsbüros in der Schweiz.» Dabei sei das Land gerade jetzt auf ein leistungsfähiges, resilientes Planungswesen angewiesen – insbesondere, um politische Ziele wie die Klimaneutralität zu erreichen.
«Umso bedauerlicher ist es», heisst es in der Stellungnahme des SIA weiter, «dass sich die neue Praxis von Stadt und Kanton Zürich bereits in weiteren Kantonen, Gemeinden und auch privaten Bauherrschaften abzeichnet.»
Diesen «negativen Vorbildcharakter» bestätigt Lilitt Bollinger ebenfalls: «Leider hat sich die Nachricht aus Zürich wie ein Lauffeuer in der Schweiz verbreitet und weitere Hochbauämter führen Rückindexierungen ein.»
Wie geht es weiter?
Laurindo Lietha, Verantwortlicher Beschaffungswesen, Berufsgruppen Architektur und Ingenieurbau, Internationales beim SIA, kündigt nächste Schritte an: «Die Stadt und der Kanton haben Gesprächsbereitschaft signalisiert. Wir sind zuversichtlich, gemeinsam partnerschaftlich Lösungen zu finden, die sowohl die wirtschaftliche Realität der Planungsbüros anerkennt als auch die Interessen der Bauherrschaften ernst nimmt.»
Dies sei auch im Sinne des BSA: «Der BSA befürwortet eine rasche Aufnahme von Gesprächen mit Stadt und Kanton Zürich unter der Federführung des SIA», bekräftigt Lilitt Bollinger. «Er unterstützt die Zürcher Arbeitsgruppe Honorare, die breitere Kreise für das Thema sensibilisiert hat und mit ihrer fundierten Expertise aus der Praxis stets in diesen Prozess eingebunden sein sollte.»
Neues SIA-Tool angekündigt
Lietha wiederum verweist auf die neue Plattform zur Aufwandermittlung: Diese zeichne sich gerade dadurch aus, dass sie nicht mehr auf den Baukosten als determinierende Grösse abstelle, sondern diverse Aspekte des Projekts und dessen Organisation berücksichtige. «Mit der Plattform Aufwand und der Value App sind die nötigen Grundlagen für eine partnerschaftliche Lösung geschaffen», sagt Lietha.
Ausführlich informiert der SIA im Beitrag «Paradigmenwechsel in der Planungshonorierung» vom 15. Juli. Die Markteinführung der Plattform für Architekturleistungen nach SIA 102 erfolgt im August 2025. Der SIA wird sie kommunikativ begleiten und die Verbreitung unter den Auslobenden fördern.
«Der Bedarf ist unbestritten da», meint Lietha trocken. Dem kann man nur beipflichten – und hoffen, dass die Beteiligten eine partnerschaftliche Lösung erreichen.