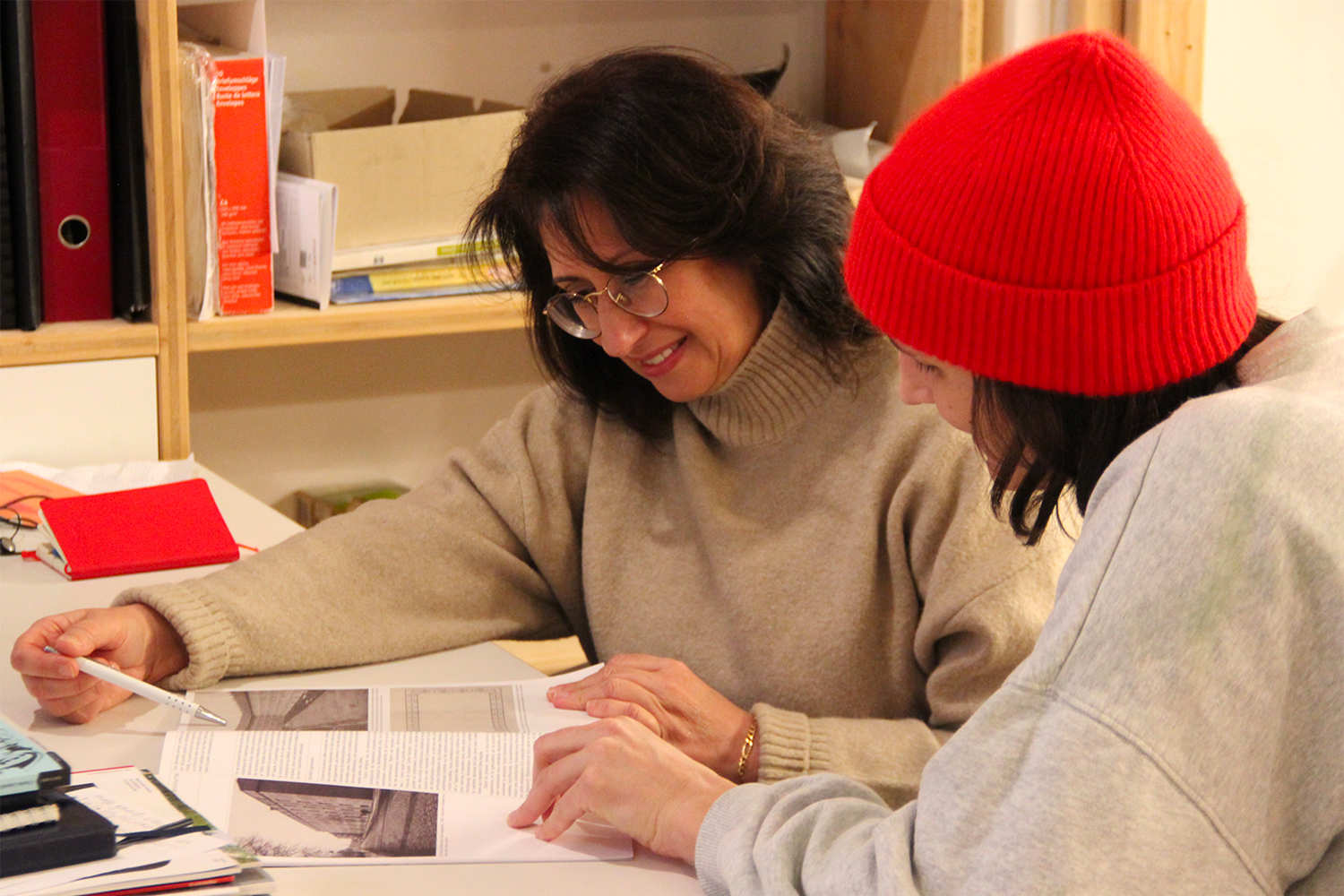SIA: Gemeinsam Ziele verfolgen
Entgegnung des Heimatschutz-Präsidenten auf einen Artikel von Stefan Cadosch
Der bevorstehende Nationalrats-Entscheid zur Kulturbotschaft 20162020 erfordert im politischen Diskurs mehr denn je eine starke, geeinte Stimme aller Fachleute, die sich mit der Gestaltung unserer gebauten Umwelt auseinandersetzen.
Der SIA will vermehrt Einfluss auf das politische Geschehen beim Bund nehmen, wie es sein Präsident Stefan Cadosch in seinem Editorial zum Jahresanfang im TEC21 und in der französischsprachigen Schwesterzeitschrift TRACÉS postuliert. Der Schweizer Heimatschutz ist erfreut, dass der SIA als Verband mit seinen ausgewiesenen Fachleuten diesen Weg seit einiger Zeit beschreitet.
Wer, wenn nicht der SIA und sein Schwesterverband, der FSU, könnte diese Rolle besser und glaubhafter einnehmen? Einen wichtigen Meilenstein hat der SIA bereits 2010 gesetzt: er hat den «Runden Tisch Baukultur» ins Leben gerufen. Die damals begonnene Zusammenarbeit gilt es heute zu konkretisieren. Denn zeitgenössische Baukultur findet in Zukunft allem voran innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets statt. Die Schweiz ist jedoch vielerorts noch nicht vorbereitet auf diesen vollständigen Wandel hin zu einer qualitätsvollen und nachhaltigen Verdichtung. Umso mehr müssen die Kräfte zusammenstehen, die sich für mehr Qualität im Siedlungsraum einsetzen.
Auch der Schweizer Heimatschutz stellt sich voll und ganz hinter dieses Manifest, das ein umfassendes Verständnis für historische und zeitgenössische Baukultur einfordert. Der SIA hat sich auf dessen Basis zum Ziel gesetzt, das zeitgenössische baukulturelle Schaffen auf nationaler Ebene zu stärken. Dank grossem Aufwand ist es ihm gelungen, einen Anker in der kommenden Kulturbotschaft zu setzen. Der Bundesrat schlägt zuhanden der Eidgenössischen Räte vor, einen neuen Förderbereich mit einem Budget von jährlich einer halben Million Franken aufzubauen. In seiner Stellungnahme zur Kulturbotschaft 20162020 hat der Schweizer Heimatschutz diesen neuen Förderbereich ausdrücklich begrüsst. Aktuell will die nationalrätliche Finanzkommission diese zusätzlichen finanziellen Mittel jedoch streichen.
Dezidiertes Engagement des Heimatschutzes
Wer die rege politische Tätigkeit, das publizistische Engagement des Schweizer Heimatschutzes im letzten Jahrzehnt mitverfolgt hat, weiss, dass wir die qualitätsvolle Entwicklung unserer Siedlungen und Kulturlandschaften dezidiert einfordern. Eine Gemeinde, die den begehrten Wakkerpreis des Schweizer Heimatschutzes gewinnen will, muss seit Jahrzehnten plausibel aufzeigen, wie sie sich aus dem Bestehenden erneuert und entwickelt. Dasselbe gilt für unseren Schulthess Gartenpreis, mit dem wir letztes Jahr etwa die Stadt Uster dafür auszeichneten, dass sie sich auf ihre industriellen Wurzeln besann und daraus eine neue landschaftliche und städtebauliche Identität erschuf.
Knappe Finanzen zielgerichtet einsetzen
Der Präsident des SIA täuscht sich also, wenn er in TEC21 und TRACÉS schreibt: [Nun] «stemmt sich der Wertschätzung zeitgenössischen Bauens plötzlich mit dem Schweizer Heimatschutz eine Kraft entgegen». Das ist falsch.
Die «zeitgenössische Baukultur» soll gemäss Bundesrat mit jährlich einer halben Million Franken unterstützt werden. Der Ständerat als Erstrat hat mit dem genehmigten Rahmenkredit auch stillschweigend die Mittel für die zeitgenössische Baukultur zugesprochen. Gemessen an anderen Sensibilisierungsmassnahmen, die der Bund unterstützt, ist dieser Beitrag mehr als bescheiden. Um tatsächlich mit knappen Mitteln erfolgreich zu sein, müssen vorhandene Ressourcen und Netzwerke zielgerichtet aktiviert werden.
Der Bundesrat schlägt einerseits vor, durch regelmässige Gespräche und einzelne Leuchtturmprojekte die Bedeutung von qualitätsvollem Bauen in der Bundesverwaltung zu stärken. Dem ist voll und ganz zuzustimmen: Zahlreiche Gesetze und Verordnungen werden ohne den Beizug von Experten der Baukultur erlassen etwa in der Landwirtschaft, im Strassenbau oder in den Bereichen Energie und Raumplanung. Das Schliessen dieser Lücke würde zahlreiche Missstände beheben.
Einen gemeinsamen Kurs einschlagen
Andererseits möchte der Bund den übrigen Teil der Mittel für die Kommunikation von Anliegen der Baukultur gegen aussen aufwenden. Auch dies ist wünschenswert. Nur setzen wir Fragezeichen gegenüber der vorgeschlagenen Strategie. Anstatt sich auf die Kernkompetenzen des Bundesamts für Kultur zu stützen und die bescheidenen Ressourcen zielgerichtet zu aktivieren, sollen neue Partner gesucht werden. Kann ein solches Ruderboot, das mit bescheidenen Finanzmitteln gezimmert wird, gegen die Fregatten und Kanonenboote anderer Interessensverbände tatsächlich bestehen
Ich bleibe bei den Metaphern aus der Schifffahrt. Eines der einstigen Flaggschiffe des Bundesamts für Kultur ist im Moment ein wenig in Schieflage: die Denkmalpflege. Die Kulturbotschaft des Bundes hält fest, dass jährlich rund 100 Millionen Franken nötig wären, um den eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen. Sprechen will der Bundesrat letztlich 28.5 Millionen davon. Er lässt ausrichten, dass mehr Vermittlungsarbeit notwendig wäre, um das Nachkommen der eingegangenen Verpflichtungen zu legitimieren. Bedrängt wird das Flaggschiff «Denkmalpflege» von einer ganzen Armada, die kurzsichtige Eigeninteressen durchsetzen will. Wäre es nicht sinnvoll, wenn sich das Bundesamt für Kultur über den neuen Fördertopf der «zeitgenössischen Baukultur» auf Fragen des Neben- und Miteinanders von historischer und zeitgenössischer Baukultur konzentrieren würde? Damit liesse sich zeigen, dass eine hohe Qualität des Bauens zeitlos und damit auch nachhaltig ist.
Gemeinsam müssen alle Freunde der Baukultur neue Wege und Lösungen finden, um ihre Aktivitäten zu koordinieren. Nur so können wir uns Gehör verschaffen. Unsere Schiffe sind nicht gross. Dafür kennen wir uns gut aus und können gemeinsam gezielt eingreifen. Daher wünsche ich mir, dass wir gemeinsam für eine lebenswerte gebaute Umwelt eintreten. Die Schweiz ist angewiesen auf die Fachkompetenz ihrer Architektinnen und Ingenieure, Landschaftsgestalter, Raumplanerinnen, Denkmalpfleger und Heimatschützer. Das Manifest Baukultur ist ein Kompass, mit dem wir unsere Kräfte bündeln können. Und dazu braucht es eine stärkere Zusammenarbeit als bisher. Für eine hochwertig gestaltete, lebenswerte Schweiz, die sich optimal entwickelt und dabei ihren Wurzeln Rechnung trägt.